Wider die „kriegsbesoffene Versfußtruppe“
Als Österreich-Ungarn gemeinsam mit dem deutschen Kaiserreich im Sommer 1914 den Ersten Weltkrieg lostrat, sahen viele auch eine Lizenz zum verbalen Losschlagen. Hunderttausende verfertigten patriotische Gedichte, unterzeichneten Erklärungen und verfassten Leserbriefe. Wenige nur stimmten nicht in das Kriegsgeschrei ein, einer nur erhob seine Stimme dagegen: Karl Kraus.
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
Auch Dichter und Intellektuelle erlagen dem kollektiven Taumel und berauschten sich an der „großen Sache“. Hugo von Hofmannsthal bekundete eine „Freude (...), wie ich sie nie erlebt habe, ja nie für möglich gehalten hätte“, Stefan Zweig schrieb dem Krieg „etwas Großartiges, Hinreißendes“ zu, Rainer Maria Rilke spürte ein neues Gemeinschaftsgefühl: „Wir glühen in eins zusammen“ und frohlockte, „endlich ein Gott“. Und der Psychoanalytiker Sigmund Freud sagte: „Meine ganze Libido gehört Österreich-Ungarn.“
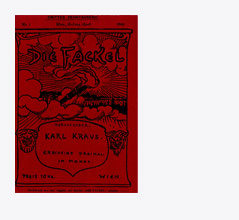
Public Domain
„Die Fackel“ war die einzige deutschsprachige Zeitschrift, die von Anfang bis Ende des Krieges gegen diesen anschrieb
„In dieser großen Zeit“
„Die, welche sterben müssen oder ihren Besitz opfern, haben das Leben und sind reich“, bemerkte Robert Musil und gliederte sich in die „Versfußtruppe einer kriegsbesoffenen deutschen Literatur“ ebenso ein wie Peter Rosegger, Alfred Kerr, Felix Salten, Anton Wildgans und Egon Friedell, aber auch Gerhart Hauptmann, Thomas Mann und Max Weber. Die meisten glaubten an einen schnellen Sieg. Kraus, der die Kriegsdauer mit zwei Jahren selbst unterschätzte, galt als Pessimist. „In solchen Fällen lässt sich nicht mit mathematischer, sondern nur mit apokalyptischer Genauigkeit arbeiten“, befand er später.
In der im Dezember 1914 in der „Fackel“ abgedruckten Rede „In dieser großen Zeit“ verlieh Kraus seiner Abscheu vor den verbalen Säbelrasslern Ausdruck. „Die jetzt nichts zu sagen haben, weil die Tat das Wort hat, sprechen weiter. Wer etwas zu sagen hat, trete vor und schweige!“ Die nächste „Fackel“ begann mit dem Satz: „Ich bin jetzt nur ein einfacher Zeitungsleser“ und griff erneut das „Sprachgesindel, dem der Anblick unnennbaren Grauens nicht die Zunge gelähmt, sondern flott gemacht hat“, an.
Das Versagen der Vorstellungskraft
Ohne das Zutun des „Sprachgesindels“, so Kraus’ Überzeugung, wäre „dieser Krieg der berauschten Phantasiearmut nicht entbrannt“. Wie später Günther Anders mit seiner Philosophie im Zeitalter der Atombombe erkannte Kraus das Versagen der Vorstellungskraft als den eigentlichen Grund des Krieges: „Es ist die Zeit, in der eben das geschieht, was man sich nicht vorstellen konnte, und in der geschehen muss, was man sich nicht mehr vorstellen kann, und könnte man es, es geschähe nicht.“
Die Ursache für die Vorstellungsunfähigkeit fand Kraus nicht einfach in einer kriegsverherrlichenden Propaganda, sondern in der „Verlotterung der Sprache“ selbst. Diese begriff er weder als Abstraktum noch als System, vielmehr als das wirkliche, also historische Sprechen der Zeit. An Art und Ausmaß, wie Menschen die Sprache zurichten, las er ab, wie sie zugerichtet sind und einander zurichten. Stilkritik verwandelte sich so in Ideologiekritik: „Dass einer ein Mörder ist, muss nichts gegen seinen Stil beweisen. Aber der Stil kann beweisen, dass er ein Mörder ist.“
Öffentliches Sprechen - und dabei vor allem jenes der zu „Phrase und Vorrat erstarrten“ Presse - diente Kraus als Beweis für die Deformation der Welt. Als die Katastrophe schließlich hereinbrach, bestätigte sich ihm nur, was im Sprachverfall längst offenbar war: „(Der Reporter) hat durch jahrzehntelange Übung die Menschheit auf eben jenen Stand der Phantasienot gebracht, der ihr einen Vernichtungskrieg gegen sich selbst ermöglicht.“
„Ist die Presse ein Bote? Nein“
Kraus’ Sprachkritik nahm Marshal McLuhans Gleichsetzung von „medium“ und „message“ vorweg, weil sie das neue Massenmedium als eines auffasste, das Realität nicht mehr vermittelte, sondern nun selbst die Wirklichkeit war und die mit ihm korrespondierende Vorstellung von Wirklichkeit ersetzte. „Ist die Presse ein Bote? Nein: das Ereignis. Eine Rede? Nein: das Leben“, stellte Kraus fest. Hier wurde Krieg bereits als mediales Ereignis erfahren.
„Eines der ärgsten Kriegsgräuel, die der Menschenwürde in diesem Krieg angetan wurden“, war Kraus die Kriegsberichterstatterin Alice Schalek, dieses „Monstrum eines Bramarbas mit Lorgnon“, die besonders „mutig“ auftrat, die Stellungen in den Dolomiten und an der Isonzo-Front aufsuchte - und von den Massakern als vom „Putzen der Schützengräben“ sprach. In ihrem Tun sah Kraus „das Schauspiel einer Entartung", das dann im Irak-Krieg 2003 den Begriff „embedded Journalism“ („eingebetteter Journalismus“) bekam.
Moralische Vorstellungskraft hieß für Kraus, hinter der Heldenrhetorik und den abstrakten Statistiken zu begreifen, dass auf den Schlachtfeldern leibhaftige Menschen elend zugrunde gingen. „Was hattest du dort zu suchen“, gedachte er 1917 eines gefallenen Freundes, „zu warten, bis der Granatsplitter kam? Zu beweisen, dass dein Leib gegen die Leistungsfähigkeit der Schneider-Creuzot-Werke widerstandsfähiger sei als der eines Turiners gegen den Skoda?“ Wieder und wieder führte Kraus die Todesmaschinerie der „chlorreichen Offensive“ vor Augen und wandte sich leidenschaftlich gegen das „technorromantische Abenteuer“.
Absatzgebiete und Schlachtfelder
Nicht allein Sprachverfall und Phrase wurden als Schuldige identifiziert, sondern auch Politik, Militär und Kapital. Die Ereignisse von 1914 bis 1918 entlarvte Kraus als einen wirtschaftlich motivierten Expansionskrieg, bei dem es darum ging, „Absatzgebiete in Schlachtfelder zu verwandeln, damit aus diesen wieder Absatzgebiete werden“, und urteilte: „Dass sich eine Menschheit, die ihre Phantasie auf die Erfindung von Gasbomben ausgegeben hat, deren Wirksamkeit am 1. August 1914 nicht vorstellen konnte, macht sie erbarmungswürdig. Dass sie aber auch von der magischen Anziehungskraft des Blutes auf das Geld keine Vorstellung hatte, macht sie verächtlich.“
„Will man wissen, wie der neue Krieg aussieht, so genügt der Blick auf das leere Schlachtfeld des anonymen Todes, auf den Kampfplatz ohne Kampf, wo der Zufall zwischen Mensch und Maschine entscheidet, und dann zurück in einen warenlosen Kommerz, das noch nie das Ding gesehen hat, von dem er lebt - eins dem anderen ein Gleichnis (...) Die Verbindung jener, die die Menschheit wie eine Ware schieben, mit jenen, die die Ware schieben“, so Kraus.
Buchhinweise
- Helmut Arntzen: Karl Kraus. Peter Lang, 242 Seiten, 46,10 Euro.
- Paul Schick: Karl Kraus. Rororo, 168 Seiten (nur noch in Antiquariaten erhältlich).
- Richard Schuberth: 30 Anstiftungen zum Wiederentdecken von Karl Kraus. Turia & Kant, 237 Seiten, 24 Euro.
„Die grellsten Erfindungen sind Zitate“
Vieles, was in den Kriegsjahren in der „Fackel“ erschien, verarbeitete Kraus auch in seinem für ein „Marstheater“ gedachten Monumentaldrama „Die letzten Tage der Menschheit“, das er allerdings erst 1919, nach der Aufhebung der Zensur veröffentlichen konnte. 700 Seiten und 219 Szenen umfasst dieses ausufernde Pandämonium verblödeter Generäle, Offiziere und Adliger, korrupter Minister, Beamter und Redakteure, schmieriger Künstler, Schieber und Kriegsgewinnler, Waffen segnender Priester, sadistischer Richter und lynchgieriger Leute.
Von Akt zu Akt steigern sich der Wahnsinn des Krieges und die Absurdität des Verhaltens an der Heimatfront bis zum Weltuntergang. Doch die Realität gewinnt auch hier den Wettlauf mit der Satire: „Die unwahrscheinlichsten Taten, die hier gemeldet werden, sind wirklich geschehen“, schrieb Kraus, „ich habe gemalt, was sie nur taten. Die unwahrscheinlichsten Gespräche, die hier geführt werden, sind wörtlich gesprochen worden; die grellsten Erfindungen sind Zitate.“
Armin Sattler, ORF.at
Links:
- Karl Kraus (Wikipedia)
- Die Fackel (digitale Edition der Österreichischen Akademie der Wissenschaften)