Proust verfallen
Von 1905 bis zu seinem Tod im Jahr 1922 verfasste Marcel Proust in den abgedunkelten, stickigen Zimmern seiner Pariser Wohnung mit „A la recherche du temps perdu“ („Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“) eines der größten Werke der Literatur.
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
Erst der Tod seiner Eltern hatte den hochneurotischen, nie sich um seine wirtschaftliche Existenz kümmernden, aber stets auf großem Fuß lebenden Proust zur Tat schreiten lassen: Wenige Monate vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs erschien am 14. November 1913 mit „In Swanns Welt“ der erste Teil der „Recherche“. Erst 1927 - fünf Jahre nach Prousts Tod - erschien der siebente und letzte Band.
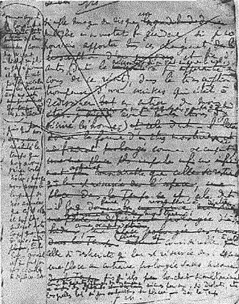
Public Domain
Die letzte Seite des Manuskripts
Vor und jenseits der Postmoderne
Kurz vor der ersten Großkatastrophe der Moderne verfasste also jener Mann, von dem viele eher die Anekdoten und Dramen seines skandalumwitterten Lebens denn seine „Recherche“ kennen, den ersten Teil des ersten - vor allem in philosophischer Hinsicht - postmodernen Monumentalwerks. Anders als die Postmoderne des späten 20. Jahrhunderts begnügt sich Proust jedoch darin und in der gesamten „Recherche“ nie damit, den Glauben an jeglichen sinnstiftenden Zusammenhang im Leben zu demontieren und als wahlweise snobistische oder tragische Illusion zu identifizieren. Vielmehr ist in jeder Zeile darüber hinaus eine große Sehnsucht danach zu spüren, in diesem Dekonstruktionsjenseits eine neue, innere Heimat zu finden, in der das „Ich“ sich spüren und sehen kann.
Wer sich auf Proust mit Haut und Haar einlässt, wird belohnt: Für die Dauer der Lektüre befreit Proust mit einer vorher und nachher einzigartigen Grandezza auf einer atemberaubend langsamen Reise aus der gnadenlosen Mühle der Zeit. Den Leser erwartet auch 100 Jahre später eine unvergleichliche Begegnung mit dem sensiblen jüdischen Aufsteiger Swann, der vom Ich-Erzähler (der zweimal im gesamten Roman als Marcel beim Namen genannt wird) umworbenen und mit rasender Eifersucht bedachten Albertine, dem - zu Beginn des Romans - an der Spitze der sozialen Hierarchie stehenden Herzogpaars der De Guermantes, dem sadomasochistischen Dandy Baron de Charlus, dem Schriftsteller Bergotte und Dutzenden weiteren Gestalten - und, in all diesen Personen, mit sich selbst.
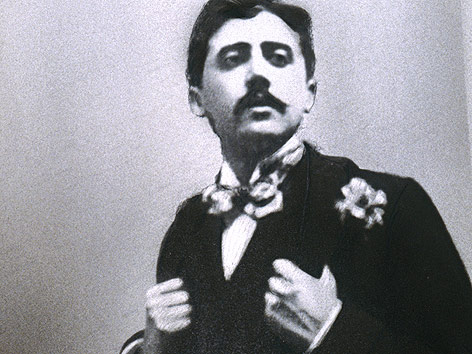
Corbis/Sygma
Proust in selbstbewusster Pose im Jahr 1895
Der unbemerkbare Wandel
Während der eigentliche Handlungsstrang rund um die Hauptfigur mehr als dünn ist, wird der Leser mit einer in seiner Vielzahl an Themen und Personen, die im Laufe des Romans auf verschiedenste Weise in Wechselbeziehung zueinander gebracht werden, seltenen Dichte belohnt - man kann tatsächlich von Romanen im Roman sprechen. Die Pariser Oberschicht im Umbruch wird aus unendlich vielen Perspektiven betrachtet und dekonstruiert und so zu einer zeitlosen Studie darüber, wie gesellschaftliche Umwälzungen - und das ist das Entscheidende: von den handelnden Personen unbemerkt - vonstatten gehen.
Im Zentrum steht der Ich-Erzähler, der im Roman sein Leben von der Kindheit bis ins Alter in Erinnerung ruft - und im Verlauf des Romans das Schriftstellersein durch eine „unwillkürliche Erinnerung“ als seine Berufung erfährt. Der Roman endet mit der Pointe, dass der Ich-Erzähler den Plan fasst, der verlorenen Zeit schriftstellerisch nachzuspüren - ein Plan, den Proust dann bereits in die Realität umgesetzt hat.
Von Andre Gide abgelehnt
Proust musste die Druckkosten für „In Swanns Welt“ aus der eigenen Tasche bezahlen. Unter anderem hatte Andre Gide, als Lektor vom Verlag NRF beauftragt, das Werk abgelehnt. Gide sah seinen Fehler bald nach Erscheinen von „Du cote de chez Swann“ ein und entschuldigte sich bei Proust.
Die „Proust’sche Finte“
Höhe- und Endpunkt ist seine Erkenntnis, „dass Zeit verloren werden musste, damit sie überhaupt wieder erinnert werden kann“, versucht der deutsche Literaturkritiker Jürgen Ritte im Interview mit dem DeutschlandRadio den Kerngedanken des Werks zu benennen. Die „Proust’sche Finte“ sei es, dass man „eigentlich nur retrospektiv in der Erinnerung, nie in der Gegenwart“ etwas erlebt. In diesem Sinne ist es nur logisch, dass der letzte Band der Recherche „Die wiedergefundene Zeit“ lautet.
„Unwirklichkeit des Wirklichen“
Bis heute gültig ist Jean Amerys Empfehlung der Proust-Lektüre - 1971 zum 100. Geburtstag des Autors in der Zeitschrift „Merkur“ erschienen: Prousts Roman zeige die „Unmöglichkeit, im Roman über die Realität Verbindliches auszusagen“. „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ beschreibe die „Unwirklichkeit des Wirklichen“. „Die Leistung dieses Autors besteht in der Sichtbarmachung der Unerkennbarkeit. Niemand vor ihm, kaum einer nach ihm hat eine solche Mühe aufgewendet, Realität dichterisch nicht zu suggerieren, sondern zu erkennen. Und bei keinem anderen wurde das schließliche Scheitern des vorgenommenen Unternehmens zu einem vergleichbaren künstlerischen Triumph.“

Public Domain
Proust als 15-Jähriger
Was bleibt, nach der tausende Seiten langen Lektüre, ist ein einzigartiges Leseerlebnis. Die quälend gefühlte Erkenntnis, wie beengend und beklemmend sich das Leben anfühlen kann: unkalibriert ausschlagend zwischen Verzweiflung, schmerzlichen Niederlagen, Momenten des vergänglichen Triumphs und der Hoffnung, jenseits der Erfahrung, dass das Leben Chaos und Willkür ohne übergeordneten Sinn ist, eine Berufung für das eigene Leben zu finden. Schwindelerregend sind jene immer wieder vorkommenden Szenen, in denen der Leser mit dem Ich-Erzähler in „unwillkürlicher Erinnerung“ durch alle Zeit hindurchfällt - beispielhaft dafür wurde die Madeleine-Szene aus „In Swanns Welt“. Ein Kleingebäck, das der bereits erwachsenen Hauptperson von seiner Mutter serviert wird. Der Geschmack der Madeleine lässt plötzlich umfassend seine gesamte Kindheit vor ihm aufstehen.
Der kostbarste Besitz
Am Ende der Lektüre ist auch der Leser dort angekommen, wo Marcel Proust und der Ich-Erzähler Marcel sich bereits befinden: in der Leere. Nochmals Jean Amery: „Doch ist diese Leere unser kostbarster Besitz. Wer sie nicht kennt, weiß nichts von einer Welt, die Wille ist und Vorstellung, die unser Ich bündelt, das wir so wenig uns aneignen können wie der Erzähler sich die Kirchtürme von Martinville und die kleine Melodie von Vinteuil.“
Guido Tiefenthaler, ORF.at
Links: