„Gepflegter junger Mann“ eher bartlos
Wie Jesus wirklich aussah, weiß niemand: Im Neuen Testament findet sich dazu kein Anhaltspunkt. Auch die Kirchenväter des ersten und zweiten Jahrhunderts geben - wohl um eine unerwünschte Bilderverehrung zu vermeiden - keinerlei Auskunft über Jesu Erscheinungsbild, folglich auch nicht über seinen Bart.
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
Der Historiker Karl Brunner stellt ihn sich eher bartlos vor: „Ein gepflegter junger Mann der jüdischen Mittelschicht im römischen Kulturkreis hatte eher keinen Bart“, sagte er gegenüber ORF.at. Als Zimmermann habe Jesus dieser Schicht angehört, ebenso wie seine Jünger. Rasieren sei damals teuer und den Wohlhabenderen vorbehalten gewesen, daher habe man sich vermutlich nur einmal in der Woche rasiert. Falls Jesus vor dem Pessach-Fest begraben wurde, wie es die Bibel sagt, dürfte sein Bart zum Zeitpunkt der Kreuzigung am ehesten eine Art Dreitagesbart gewesen sein, denn kurz vor dem Fest wäre eine Rasur religiöse Pflicht gewesen, so Brunner. Dazu wäre Jesus aber nicht mehr gekommen.
Antike Darstellungen: Einmal mit, einmal ohne
Ebenso interessant wie Überlegungen zum tatsächlichen Bartstatus des historischen Jesus ist die Frage nach der Ikonographie, der bildlichen Darstellung seiner Person. Statt durch Bilder von ihm selbst wurde Christus in der Antike zunächst eher durch seine Symbole repräsentiert wie durch den Fisch, ein Kreuz oder sein Monogramm.
In den apokryphen Schriften (Texte, die um biblische Themen kreisen, aber nicht formal der Bibel zugehörig sind) findet sich die Beschreibung von Jesus als gutaussehendem jugendlichem Mann. In frühen Darstellungen ab dem dritten Jahrhundert wird Jesus gern im Gewand des „guten Hirten“ gezeigt. Er trägt darin gewöhnlich keinen Bart und kurzes Haar, ganz in der römischen Tradition. In dieser unspezifischen Erscheinungsform wird der jugendliche Jesus auch gern mit dem griechischen Sängerhelden Orpheus verglichen.

Public Domain; picturedesk.com/United Archives/DEA
Jesus als der „gute Hirte“ in einer Darstellung aus dem dritten Jahrhundert (l.) und Kreuzigungsszene von Bernardino Luini (ca. 1481 bis ca. 1532)
In den Darstellungen der Spätantike variiert das Äußere Jesu noch stark. Er wird ebenso oft als agiler und bartloser Jüngling in der Tradition von Bildern des griechischen Gottes Apollo gezeigt wie als weiser, gesetzter Bartträger. Die ältesten beiden Kreuzigungsbilder, die sicher datiert werden können, stammen aus dem fünften Jahrhundert. Eines davon, ein Holzrelief um 430 aus Rom, zeigt Jesus mit Bart, das zweite, eine Elfenbeinarbeit aus Italien von 420 bis 430, stellt ihn mit glattem Gesicht dar.
Ein Bildnis, nicht von Menschenhand gemacht
Die Vorstellung, einem möglichst getreuen Abbild von Jesus wohne eine göttliche Kraft inne, gewann ab dem vierten Jahrhundert in Byzanz zunehmend Anhänger. Christusbilder in Grabstätten und Haushalten, sogar auf Gewändern wurden üblich. Damit stellte sich auch die Frage nach seinem Aussehen wieder dringlicher.
Dem Wunsch, das Gesicht von Christus zu „kennen“, kam im sechsten Jahrhundert die Verbreitung von Acheiropoieten entgegen. Diese Bilder oder Abdrücke auf Mauern, Ziegeln und Säulen, die der Legende nach nicht von Menschenhand, sondern „durch göttliches Zutun“ entstanden, kamen in Syrien und Kleinasien auf und stellten zumeist Jesus oder Maria dar. Eines der bekanntesten Acheiropoieten ist das Abgar-Bild, ein vermeintlicher Abdruck von Jesus Christus’ Gesicht auf einem Tuch.

by-sa Hephaestos le Bancal; Public Domain
Das Abgar-Bild (l.) und das Schweißtuch der Veronika (r.) gelten als Vorbilder für die Ikonen der Ostkirche
Die ursprüngliche Legende besagte, ein Bote des Fürsten Abgar V. von Edessa in der heutigen Türkei habe in dessen Auftrag ein Bild von Jesus zu dessen Lebzeiten gemalt. Von einem Briefwechsel zwischen Jesus und Abgar, der um Heilung seiner Krankheit bat, berichtet der Kirchengeschichtsschreiber und Kirchenvater Eusebius. In einer späteren Legende ist die Rede davon, Christus habe selbst einen Abdruck seines Gesichts auf einem Schweißtuch an Abgar gesandt. Dieses Schweißtuch oder Mandylion, das nach Konstantinopel gebracht wurde und später im Zuge der Kreuzzüge nach Europa gelangte, wurde das Vorbild für die Christusikone schlechthin. Es zeigt ein frontal gemaltes Gesicht mit langer Nase, das ein Bart ziert.
Mittelalter: Vollbart setzt sich durch
Seit dem sechsten Jahrhundert trägt Jesus dann durchgehend einen Vollbart. In diese Zeit fällt auch die Entstehung der Veronika-Legende, die ebenfalls um ein Schweißtuch mit dem eingeprägten Gesicht Christi kreist. Die spätere Heilige soll Jesus auf seinem Kreuzweg nach Golgatha das Tuch gereicht haben, um sich Schweiß und Blut damit abzuwischen. Auf dem Tuch verblieb ein perfekter Abdrucks seines Gesichts. Auch das Schweißtuch der Veronika zeigt in allen Darstellungen ein bärtiges Gesicht.
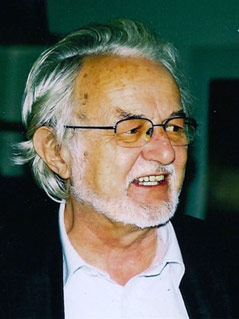
Maleczek
Historiker Karl Brunner
Die Grundlage für den heute vertrauten Typus war gelegt: Diese beiden Abdrücke stellen das Idealbild dar, nach dem künftige Jesus-Darstellungen zumeist gestaltet wurden. „Das Veronika-Bild wirkte ganz stark weiter“, sagt Brunner. „Wenn ein Ikonenbild einmal konstituiert ist, ist eine Variante nicht mehr möglich, weil es ‚das wahre Gesicht Gottes‘ ist.“ Dem Vorbild des bärtigen, eher langhaarigen Jesus kommt auch das umstrittene Turiner Grabtuch nach. Das Stoffstück, auf dem sich die Umrisse eines männlichen Körpers abzeichnen, ist in den Augen von vielen Gläubigen heute das Totentuch, in das Jesus bei seiner Grablegung gewickelt wurde. „Darstellungen kann es viele gegeben haben“, so Brunner, „bis dann eine in die passenden Hände kam.“
Die Hervorhebung des Bartes muss da nicht unbedingt bewusst geschehen sein: Der Bart sei jedenfalls in die Ikone hineingekommen, so der Historiker. Und er passte durchaus in die Zeit: Die weltlichen Herrscher des Mittelalters trugen häufig Vollbart. Dieser „Herrscherbart“, wie ihn etwa Friedrich I. Barbarossa (1122 bis 1190) im Gesicht wie auch im Namen trug, sollte dem Kaiser oder König Würde verleihen und ihn vom gemeinen Volk abheben.
Ikonographie der Barttypen
Man müsste sich freilich die Jesus-Bilder jeweils einzeln anschauen - die Frage sei auch, was der jeweilige Künstler bezweckt habe, sagt Brunner. Ein weiterer Barttypus in der Ikonographie neben dem Herrscherbart sei der „Weisheitsbart“, wie ihn Propheten auf Bildern tragen. Der eher kurze, gestutzte Bart, mit dem Jesus gewöhnlich dargestellt wird, passt nicht ganz in diesen Typus des wallenden Prophetenbarts. Dieser dient ähnlich dem Herrscherbart der Hervorhebung einer Person und der Verleihung einer Aura von Weisheit und Würde. So wird der „Chefapostel“ Petrus mit Bart dargestellt, der Römer Paulus allerdings ohne Gesichtsbehaarung - hier schlägt wiederum die römische Tradition durch, wonach sich angesehene Bürger glatt rasierten.
Die römische Tradition hielt sich im römisch-katholischen Klerus bis in die heutige Zeit. „Grundsätzlich hat sich im Westen durchgesetzt, dass Geistliche bartlos sein sollen“, so der Historiker Brunner gegenüber ORF.at. Auch Päpste waren und sind grundsätzlich glatt rasiert. „In der byzantinischen Tradition setzte sich der Prophetenbart durch“, so Brunner, etwa auch bei den orthodoxen Geistlichen der Ostkirche. Der gepflegte Jesus-Bart könne in diesem Kontext durchaus als „Markenzeichen“ verstanden werden, so Brunner. Aus der Bildsprache zur Geschichte von Jesus ist der Bart auf keinen Fall mehr wegzudenken.
Johanna Grillmayer, ORF.at
Links: