Die besseren Menschen
Roboter sind mythenbeladene Wesen. Sie sollen Sklaven sein, deren Versklavung dem Menschen kein schlechtes Gewissen bereitet. Gleichzeitig machen sie uns Angst, der Science-Fiction sei dank. Forscher versuchen nun den Nebel zu lichten in der Frage nach der Zukunft von Robotern.
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
Das Moore’sche Gesetz aus dem Jahr 1965 besagt, dass sich die Computerleistung alle ein bis zwei Jahre verdoppelt. Bis jetzt hat sich das im Großen und Ganzen bewahrheitet. Es ist also nur eine Frage der Zeit, wann Computer ebenso komplex denken können wie ein Mensch. Das hängt allerdings auch noch von einer zweiten Entwicklung ab: der Erforschung des menschlichen Gehirns.
Diese wird wiederum durch wachsende Rechenleistung begünstigt. Noch sind Forscher meilenweit davon entfernt zu verstehen, wie das Gehirn wirklich funktioniert. Noch können Roboter weniger komplex denken als eine Kakerlake. Michio Kaku rechnet damit, dass es in 50 bis 100 Jahren so weit sein wird. Er hat sich in seinem aktuellen Buch „Die Physik der Zukunft“ mit der Frage beschäftigt, wie wir Menschen in 100 Jahren leben werden - und welche Rolle die Technologie dabei spielt.

AP/Honda Motor Co.
Der sprechende und gehende Roboter Asimo führt hier einen Rasenmäherroboter vor. Der Humanoid selbst wurde 2004 der Öffentlichkeit präsentiert
Keine Schnellschüsse als Prognosen
Kaku, geboren 1947, gilt als einer der Väter der Stringtheorie und zählt zu den berühmtesten Physikern der Welt. Dass er sich dennoch für Laien verständlich ausdrücken kann, hat er bereits in diversen Wissenschaftsspecials in TV-Sendern wie Discovery Channel, BBC und Science Channel bewiesen. In sein Buch ließ er Interviews mit den renommiertesten Naturwissenschaftlern der Welt über verschiedenste Zukunftsthemen einfließen - von der Nanotechnologie über das Gesundheitswesen bis zur Raumfahrt.
Lange Kapitel sind den erwartbaren Entwicklungen des Computers und der Künstlichen Intelligenz gewidmet. Kakus Ausführungen muss man vor allem zugute halten, dass er bei seinen Prognosen weder ins Horn der Kulturpessimisten bläst noch blindem Forschungsglauben und Hightech-Begeisterung verfallen ist. Er gibt den Stand der Wissenschaft wieder, zitiert echte Experten ihrer Fachgebiete - keine windigen Futurologen - und operiert mit Wahrscheinlichkeiten.

APA/EPA/Paul Hilton
Gimonoid F, 2010 in Japan vorgestellt, repräsentiert die bisher intelligenteste Robotergeneration
Der Mensch als Opfer des Darwinismus
Vor diesem Hintergrund widmet sich Kaku einer schlagzeilenträchtigen Frage: Werden Roboter bald den Aufstand gegen die Menschheit wagen, die Welt regieren und uns dann versklaven, wie es in Science-Fiction-Filmen vom Schlag eines „Terminator“ durchgesponnen wurde? Manche Wissenschaftler sind davon überzeugt. Ihrer Meinung nach fällt der Mensch dem Darwinismus zum Opfer: Wer intelligenter ist als andere, kann sich besser seiner Umwelt anpassen und macht sie sich zum Untertan.
Kaku schreibt pointiert: „Vielleicht ist das unser Schicksal: Superroboter zu schaffen, die uns als peinlich primitive Fußnote der Evolution behandeln.“ Einer der prononciertesten Vertreter dieser Denkschule ist der Erfinder und Bestsellerautor Ray Kurzweil. Er meint: Schon nach 2045 seien Computer so weit fortgeschritten, dass sie intelligentere Kopien ihrer selbst herstellen können - ein Kreislauf der selbst laufenden Reproduktion.
Die Theorie der Singularität
Das würde dann zur sogenannten Singularität führen: Computer beuten die Ressourcen der Welt so aus, dass die Erdoberfläche weitgehend von Maschinen bedeckt ist und setzen ihren Siegeszug dann im Weltraum fort. Aufgrund des weiterhin exponentiellen Wachstums des technologischen Fortschritts sei das Universum in absehbarer Zeit nur noch ein einziger, vernetzter, hochintelligenter Computer.
Kurzweil und seine zahlreichen Mitstreiter, unter denen sich durchaus auch Universitätsprofessoren befinden, werden von Kritikern als semireligiöse Spinner abgetan. Kaku zitiert dazu den amerikanischen Physiker und Kognitionswissenschaftler Douglas Hofstadter: „Es handelt sich um eine innige Mischung von Unsinn und guten Ideen, und es ist sehr schwierig, beides auseinanderzudröseln, weil es sich um schlaue Leute handelt, nicht etwa um Dummköpfe.“
Drei eherne Robotergesetze
Der Theorie der Singularität werden drei andere Szenarien gegenübergestellt. Das erste fußt auf den drei Robotergesetzen des Science-Fiction-Autors Isaac Asimov (wie auch in der Verfilmung seines Romans „I, Robot“ zu sehen). Sie besagen, dass Roboter keine Menschen verletzten können sollen, den Menschen gehorchen müssen und sich selbst schützen sollen. Man brauche sie nur so zu programmieren, dass sie nicht anders handeln können.
Das Problem dabei: Wenn die Intelligenz von Computern jene der Menschen überflügelt, könnten diese sich selbst zumindest theoretisch umprogrammieren und so die Schutzmechanismen des Menschen außer Kraft setzen. In diesem Szenario sind deshalb eigene Roboter als Roboterjäger vorgesehen, die außer Kontrolle geratene Maschinen unschädlich machen sollen. Aber auch die könnten ... Man sieht, die Katze beißt sich in den Schwanz.

Reuters/Morris MacMatzen
Roboter bei der Entschärfung von Bomben (Übung der Deutschen Bundeswehr)
Wenn Maschinen lieben
Das zweite Szenario wäre die Erschaffung einer „Friendly AI“, also einer freundlichen künstlichen Intelligenz. Diesen Begriff hat Eliezer Yudkowsky, einer der Gründer des Singularity Institute for Artificial Intelligence, geprägt. Hierbei steht es den Robotern frei, Menschen zu ermorden - moralisches Verhalten soll nicht erzwungen werden.
Aber die Roboter sollen von Grund auf so entworfen werden, dass sie sich sozial verhalten - so wie im Idealfall auch Menschen. Darauf hat sich der neue Forschungszweig der „Soziorobotik“ spezialisiert. Wissenschaftler bei Hansa Robotics etwa sehen als Ziel Roboter, die „sich zu sozial intelligenten Wesen entwickeln, mit der Fähigkeit zu lieben und einen Platz in der erweiterten menschlichen Gesellschaft zu finden“.
Logik, viel Speicherplatz, vernetztes Denken und adäquate Reaktionen auf sich verändernde Situationen sind das eine - Gefühle und ein Abbild des menschlichen „Bewusstseins“ aber wieder etwas ganz anderes. Auch hier gilt: Noch lange ist die Forschung diesbezüglich nicht auf dem Stand der Natur. Bis wir uns selbst nachbilden können, müssen wir uns selbst erst genauer kennenlernen.
Ausstellungshinweise
Im Technischen Museum Wien ist ab 14. Dezember die Ausstellung „Roboter. Maschine und Mensch?“ zu sehen.
Das Ars Electronica Center in Linz widmet sich dem Thema in seiner Dauerausstellung „Wovon Maschinen träumen“.
Ich, der Roboter
Es gibt aber (zumindest) noch eine dritte Variante: Wir lassen nicht die Maschinen immer besser werden, sondern bauen sie in unseren Körper ein, um selbst immer besser zu werden. Das untersucht etwa Rodney Brooks, der frühere Direktor des MIT Artificial Intelligence Laboratory. Erste Schritte gibt es schon - in der Prothetik, wo zum Beispiel eine künstliche Hörschnecke (Cholchea) es gehörlosen Menschen ermöglicht, wieder zu hören. Dabei wird Hardware mit Nervenzellen verknüpft.
Kaku schreibt: „Wenn Cochlea- und Retinaimplantante beispielsweise das Hör- und das Sehvermögen wiederherstellen können, könnten uns die Implantate von morgen übermenschliche Fähigkeiten verleihen. Wir wären zum Beispiel in der Lage, Töne zu hören, wie sie sonst nur Hunde hören können, oder UV-, Infrarot- und Röntgenstrahlen zu sehen.“
Vom Denken ganz zu schweigen. Man stelle sich vor, Arbeitskollegen zu Weihnachten zusätzlichen Arbeitsspeicher schenken zu können oder dem Partner, der das Beziehungsjubiläum vergessen hat, eine größere Festplatte. Unser Denken könnte vernetzt über eine Art weiterentwickeltem Internet stattfinden. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt - siehe die „Matrix“-Filme oder den wegweisenden Science-Fiction-Roman „Neuromancer“ von William Gibson.
Buchhinweis
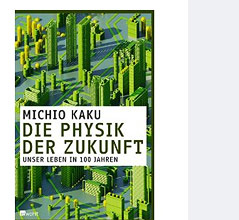
Rowohlt
Michio Kaku: Die Physik der Zukunft. Unser Leben in 100 Jahren. Rowohlt, 603 Seiten, 25,70 Euro.
Nur keine Panik - der Aufstand ist fern
Sicher ist: Bereits heute arbeiten sich zahlreiche seriöse Forscher an einem Zukunftsthema ab, das sich für die Ohren von Laien - noch - nach Science-Fiction-Schnickschnack anhört. Kürzlich gab etwa das Centre for the Study of Existential Risk der altehrwürdigen Universität von Cambridge bekannt, sich mit den Folgen eines möglichen Roboteraufstandes eingehend befassen zu wollen. Es wäre fahrlässig, sagten die Wissenschaftler gegenüber der BBC, diese Gefahr außer Acht zu lassen.
Eines der Ziele des interdisziplinären Projekts von Philosophen, Kosmologen und Physikern ist es, innerhalb der wissenschaftlichen Community mehr Aufmerksamkeit für Fragen der übermenschlichen künstlichen Intelligenz zu schaffen. Das Feld bietet mit unserem heutigen Fassungsvermögen kaum vorstellbare Möglichkeiten - und Gefahren.
Kaku winkt jedoch ab: Panik sei keineswegs angesagt. Die Entwicklung in diese Richtung werde ja nicht sprunghaft vonstatten gehen, sondern nach und nach. Bis es so weit ist, habe auch der Mensch viel dazugelernt. Und bis dahin ist noch viel Zeit, Überlebensstrategien für eine Welt zu entwickeln, in der wir Menschen nicht mehr die intelligentesten Wesen sind.
Simon Hadler, ORF.at
Links: