„Alternativwege gesucht“
Genossenschaften sind eigentlich eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Handwerker, Arbeiter und Landwirte schlossen sich zusammen, um sich gegenseitig zu helfen. Und doch rief die UNO 2012 zum Jahr der Genossenschaften aus. Für Experten ist die Entscheidung der UNO nachvollziehbar. Sie beobachten, dass Genossenschaften in den vergangenen Jahren wieder gesellschaftsfähiger wurden.
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
Die Förderung der Mitglieder, Selbstverwaltung, Hilfe zur Selbsthilfe und Solidarität gelten als Grundprinzipien der Genossenschaften. Diese Werte waren in den Hintergrund getreten. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kam in der Wissenschaft die Auffassung von Genossenschaften als „Personengemeinschaft und Unternehmung, die sich auch auf dem Markt durchsetzen und konkurrenzfähig sein müssen“, stärker zum Tragen, erklärte Genossenschaftsexperte Johann Brazda von der Universität Wien gegenüber ORF.at.
Genossenschaften in Österreich
Die österreichweit 1.865 Genossenschaften haben rund 3,3 Millionen Mitglieder, wie Zahlen des Instituts für Unternehmensführung an der Uni Wien von 2010 zeigen. Den größten Teil (1.600) nimmt der Raiffeisen-Sektor ein.
Spätestens in den 90er Jahren war die genossenschaftliche Solidarität nahezu vergessen. Gründe gäbe es viele. „Die Konsum-Pleite war dem Image der Genossenschaften sicher nicht förderlich“, gesteht auch Markus Dellinger, Rechtsberater des Österreichischen Raiffeisenverbandes, ein. „Für einige wirken Genossenschaften - wenn auch zu Unrecht - antiquiert“, glaubt Ökonom Dietmar Rößl von der Wirtschaftsuniversität Wien im ORF.at-Interview.
Profit statt Solidarität
Insbesondere bei den Kreditgenossenschaften wie im Raiffeisen- und Volksbanken-Sektor nahm der unternehmerische Gedanke zu. Eine Ursache dafür sei der gestiegene Bankenwettbewerb ab den 80er Jahren gewesen, analysierte Brazda. Mit dem Kreditwesengesetz von 1979 sei die bisherige Aufteilung der Banken - die Volksbanken für den gewerblichen Mittelstand, Raiffeisen für die Landwirtschaft und die Aktienbanken für die Industrie - aufgebrochen worden. „Man konnte sich in dieser Wettbewerbssituation nur noch in Richtung Wachstum bewegen“, so Brazda.
In diesen Überlegungen spielte Expansion eine große Rolle. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 begann für den Kreditsektor das große Rennen um das Geschäft in Osteuropa. „Das Osteuropageschäft eröffnete neue Möglichkeiten“, so Brazda. „Es ging darum, rasch den Markt zu erobern, Stärke zu zeigen, und es ging um Wachstum.“ Das Mitgliederkonzept der Genossenschaften sei dadurch aber etwas in den Hintergrund getreten.
Wettbewerbsvorteil Genossenschaft
Ähnlich sieht Hermann Fritzl vom Österreichischen Genossenschaftsverband die 90er Jahre: „Es wurde mehr auf die Gewinne an den Börsen und auf die Finanzmärkte geschaut.“ Die Wirtschaftskrise sei „sicher ein Verstärker“ gewesen, dass die Genossenschaften wieder als Alternative gesehen werden.
Konferenz in Wien
Nach knapp 50 Jahren findet von 18. bis 20. September 2012 die Internationale Genossenschaftswissenschaftliche Tagung (IGT) wieder in Wien statt. Thema der Tagung sind die „Genossenschaften im Fokus einer neuen Wirtschaftspolitik“ - mehr dazu unter IGT 2012.
Das Vertrauen in den Bankensektor ist gesunken, sind sich die Ökonomen einig. „Nach der Krise hat sich viel verändert“, sagt Brazda, die soziale Dimension in der Wirtschaft werde wieder an Bedeutung gewinnen. „Das wäre für Genossenschaften ein großer Wettbewerbsvorteil“, ist Brazda überzeugt.
Laut Rößl sei in den vergangenen Jahren der Zulauf zu den regionalen Geldinstituten wie etwa den Genossenschaftsbanken wieder größer geworden. „Mit der Wirtschaftskrise haben sie mit Überraschung gelernt, dass sie bei der Bevölkerung attraktiver sind, als sie es selbst geglaubt haben.“ Nicht zuletzt deshalb wird der genossenschaftliche Gedanke zunehmend in den Vordergrund gestellt. „Das war vor zehn Jahren noch nicht so stark“, ist Rößl überzeugt.
Weniger Insolvenzen
Die Experten gehen davon aus, dass die Kreditgenossenschaften aufgrund ihrer Kapitalreserven und der Verbundstruktur um einiges robuster seien und besser durch die Krise kämen als Aktienbanken: „Empirische Befunde zeigten, dass in der Wirtschaftskrise keine Genossenschaft ernsthaft betroffen war und sie auch seltener insolvent werden“, erklärt Rößl. Da möge zwar ein Spitzeninstitut in die Bredouille geraten, nicht aber die einzelne Genossenschaftsbank.
Als eine Erklärung für diese Stabilität sieht Rößl den unterschiedlichen Ansatz der Genossenschaften: „Vor allem Mitglieder bei neu gegründeten Genossenschaften erwarten keine Dividende, sondern treten bei, weil sie die Sache unterstützen.“ Im Vergleich der Insolvenzstatistiken über mehrere Jahre sind Genossenschaften auch prozentuell weniger von einer Pleite betroffen - nicht zuletzt auch wegen der in Österreich verpflichtenden Revision bei einem Genossenschaftsverband.
Alternative zur öffentlichen Hand
Abseits von Kreditgenossenschaften und der Möglichkeit, über Genossenschaften billiger zu wohnen, finden sich zunehmend neue Bereiche, wo diese Unternehmensform eingesetzt wird. Aufgaben, die die öffentliche Hand nicht mehr erfüllen kann oder will, werden immer mehr gemeinschaftlich in Genossenschaften organisiert: im Sozialbereich bei Kindergruppen und bei der Betreuung älterer Menschen und im Einzelhandel für die Nahversorgung, die in den vergangenen Jahren aufgrund des Greißler-Sterbens in kleineren Ortschaften nahezu eingebrochen ist.
In einigen Orten schloss sich die Bevölkerung mit der Gemeinde zusammen, um dort gemeinsam ein Lebensmittelgeschäft zu betreiben. Dort würde nun bewusster eingekauft, weiß Rößl - mit dem Hintergedanken: „Ich muss unsere Geschäft schützen.“ Brazda hingegen warnt vor allzu großen Erwartungen an intensive Kooperationen mit der Gemeinde. Die Initiative müsse von unten ausgehen. „Wenn das nicht von allen Mitgliedern getragen wird, hat das nicht lange Bestand.“
15 Neugründungen pro Jahr
Während in Deutschland nicht zuletzt aufgrund stärkerer Förderungen in letzter Zeit tatsächlich mehr Genossenschaften gegründet wurden, sehen die Experten noch keinen großen Sprung bei den Neugründungen von Genossenschaften in Österreich. Rund 15 Unternehmen werden pro Jahr genossenschaftlich gegründet, wie wissenschaftliche Studien zeigen. „Das Interesse ist aber stark gestiegen“, beobachtet etwa Rößl. „Ich denke, dass das noch mehr wird - insbesondere dort, wo die öffentliche Hand versagt, werden Genossenschaften betrieben.“
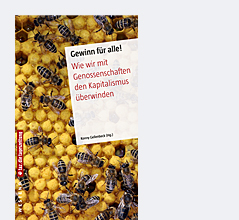
Verlag Westend
Buchhinweis
Konny Gellenbeck: Gewinn für alle! Genossenschaften als Wirtschaftsmodell der Zukunft. Westend, 252 Seiten, 13,40 Euro
Für Fritzl hängt das gestiegene Interesse auch mit der Wirtschaftskrise zusammen: „Es werden Alternativwege gesucht.“ So werden etwa im Bereich alternative Energien landwirtschaftliche Genossenschaften gegründet. Fritzl ortet beim Genossenschaftsverband aber auch mehr Gründungen im Kreativbereich, etwa bei Beratern und in der Filmindustrie. Der Vorteil der Genossenschaft: Man kann einfach ein- und wieder austreten.
Großer Anteil an Volkswirtschaft
Die volkswirtschaftliche Bedeutung von Genossenschaften ist bereits heute nicht zu verachten. „Ein wesentlicher Teil der österreichischen Wirtschaftsleistung ist genossenschaftlich geprägt. Der Großteil davon entfällt auf den Raiffeisen-Sektor mit seinen Mehrheitsbeteiligungen“, erklärt Rößl. Aufgrund der zahlreichen Beteiligungen und Vernetzungen insbesondere im Raiffeisen-Sektor sei aber die Abgrenzung schwierig, was tatsächlich in genossenschaftlicher Hand ist, so Rößl. Gerade im Raiffeisenbereich gebe es durch unterschiedliche Beteiligungen etwa in der Papier-, Versicherungs- oder Lebensmittelbranche eine „starke Verschachtelung“.
Für Dellinger vom Raiffeisenverband sind diese Vernetzungen insbesondere im Raiffeisen-Sektor ein „Vorteil“ für die österreichische Volkswirtschaft: „Das ist ein Beitrag, dass die Unternehmenszentralen in Österreich bleiben. Im Unternehmen wird so gewirtschaftet, dass die Produktion nicht dorthin verlagert wird, wo billiger produziert wird. Man fühlt sich mehr der Region verpflichtet.“
Wie genossenschaftlich ist der Raiffeisen-Konzern?
Ob diese gewachsene Konzernstruktur noch genossenschaftlichen Charakter hat, sei auf den ersten Blick tatsächlich schwer zu erkennen, sagte Rößl. Allerdings seien sich sowohl der Raiffeisen- als auch der Volksbanken-Sektor „bewusst, dass sie im Eigentum ihrer Mitglieder stehen“. Auch Raiffeisen-Generalanwalt Christian Konrad betone oft, dass Raiffeisen ein Konzern sei, der auf dem Kopf stehe - also die Mitglieder der Genossenschaften und diese selbst die Eigentümer seien. Damit zeige Konrad, dass er den „genossenschaftlichen Gedanken viel stärker trägt, als mancher vielleicht meint“, so Rößl. Wie stark der Einfluss der Mitglieder tatsächlich ist, hänge aber von den einzelnen Genossenschaft selbst ab.
Simone Leonhartsberger, ORF.at
Links: