Schmerzen als Geschäftsmodell
Politik, Moden, Wirtschaftskrisen - alles rattert über die Menschen drüber, schleift sie ab, macht sie gesellschaftskonform und gefügig. Marlene Streeruwitz schreibt Bücher über jene, die dabei unter die Räder kommen, obwohl sie dem „Opfer“-Schema nicht entsprechen. Nun ist ihr neuer Roman „Die Schmerzmacherin“ erschienen.
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
Diesmal geht es um Amy, deren Familie gut von der Prominenz des Ururgroßvaters lebt, eines nicht näher genannten Künstlers der vorletzten Jahrhundertwende, der Gustav Klimt gewesen sein könnte. Amys Mutter gab als Junkie das schwarze Schaf dieser Familie, weshalb sie selbst schon früh zu Pflegeeltern in Stockerau abgeschoben wurde. Als die Mutter sich wieder gefangen hatte, ordnete sie sich in das bürgerliche Leben wieder ein, heiratete, bekam weitere Kinder und lebte im 13. Wiener Gemeindebezirk.
Amy ließ man in Stockerau. Sie war erst wieder von Interesse, als es um einen Restitutionsfall ging. Viel Geld wäre zu holen - aber nur, wenn Amy als Teil der Erbengemeinschaft unterschreibt. Die reiche Tante aus London kümmert sich plötzlich um sie, zwar nicht liebevoll, aber sie verschafft ihr einen Ausbildungsplatz in einer Sicherheitsagentur, die unter anderem in Afghanistan operiert und an die Börse strebt.
Boshaft und radikal
Streeruwitz reißt in dem 400-Seiten-Werk ein ganzes Kaleidoskop an Themen an und wirft darauf in ihrem typischen Stroboskop-Stil Schlaglichter. Mit der Bosheit und Radikalität eines Michel Houellebecq, die in Österreich einzigartig sind, zelebriert die 1950 in Baden geborene Schriftstellerin die Devastierungen der Seele in der Dienstleistungs-, Finanz- und Netzwerkgesellschaft und delektiert sich an der Verlogenheit des Konzepts Familie.
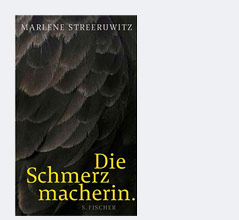
Fischer Verlag
Buchhinweis
Marlene Streeruwitz: Die Schmerzmacherin. S. Fischer, 399 Seiten, 20,60 Euro.
Dass das alles heillos zu viel ist für ein einzelnes Buch, scheint Teil des Konzepts zu sein. Amy japst nach Luft, alles ist zu schnell für sie, zu verwirrend, zu laut - nur aufgrund ihrer Schönheit und der Prominenz ihrer Familie wird sie immer weitergeschoben durch ein Leben, auf das Einfluss zu nehmen ihr viel Mühe zu machen scheint. So soll es auch den Lesenden ergehen. So wie Amy, lautet der Subtext, sind auch sie hineingeworfen in eine Welt, die dringend ein moralisches Update brauchen würde, weil die althergebrachte Ethik für die Gegenwart nicht anwendbar ist.
Der Börsenwert von Folter
Das Arbeiten in einer internationalen Firma, führt Streeruwitz vor, verkommt zu einer Castingshow. In der Ausbildung, die wie ein Assessment-Center organisiert ist, mobben sich die Jobanwärter halb zu Tode - der Intriganteste gewinnt. Das Geschäftsmodell ist flexibel. Verkauft wird, was Geld bringt, und weil in der Post-9/11-Welt Nachfrage nach Sicherheit herrscht, dann eben Sicherheit. Brutale Befragungstechniken, eigentlich Folter, werden unterrichtet, weil das die US-Armee seit kurzem lieber auslagert, um schlechte Presse zu vermeiden. Was zählt, ist lediglich der Marktwert beim Börsengang.
Die meisten der Hauptfiguren in Streeruwitz’ Romanen sind keine Widerstandskämpfer. Sie wollen funktionieren, fallen aber aus der Rolle. In „Entfernung“ (der vielleicht größte Wurf der Autorin bisher) wird etwa die Kulturmanagerin Selma durch eine jüngere Kollegin ersetzt, und als ob der daraus resultierende psychische Ausnahmezustand nicht schon reichen würde, gerät sie in die Anschläge des 7. Juli in London. Die äußere Sicherheit, die innere Sicherheit, alles weg. Und jetzt, bei „Die Schmerzmacherin“: Sämtliche Gegenmittel, das Äußere wie das Innere betreffend, sind Placebos, und wehe jenen Zauderern, die innehalten und genauer hinsehen: Danach erscheint jede weitere Sinnsuche sinnlos.
Mit viel Wodka und dem Gigolo Gino
Amy trinkt Wodka, flaschenweise, schließlich sogar schon am Vormittag, geht eine Beziehung mit dem Gigolo Gino ein und wird in der Sicherheitsagentur in immer dunklere Machenschaften verwickelt. Das Buch hat einen nachvollziehbaren Storybogen, am Ende hängt alles irgendwie zusammen. Streeruwitz zwingt mit der Peitsche in der Hand zum Weiterlesen, durch ihren Stakkatostil und die knappe Ökonomie der Erzählung - trotz vor sich hinwabernder Katastrophe. In Machoterminologie gesprochen könnte man sagen: Ihre Schreibe strotzt vor Testosteron.
Simon Hadler, ORF.at
Links: