Ausstieg schrittweise bis 2034
Noch in den letzten vier Jahrzehnten hat die Schweiz zunehmend auf den Ausbau von Atomenergie gesetzt. Obwohl der Großteil der Energie aus Wasserkraft bezogen wird, liefern mittlerweile fünf Reaktoren an vier Standorten rund 40 Prozent des Energiebedarfs. Weitere AKWs waren geplant. Davon ist nun keine Rede mehr. Ende Mai entschied sich die Schweizer Regierung für einen Atomausstieg.
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
Spätestens mit der Katastrophe im japanischen AKW Fukushima I Mitte März stieg der Widerstand der Bevölkerung gegen die Nuklearenergie. Nun zog auch die Regierung mit. Bis spätestens 2034 sollen nun alle Schweizer AKWs vom Netz sein. Bestehende Atomkraftwerke sollen nach Ablauf ihrer Betriebsdauer nicht ersetzt werden.
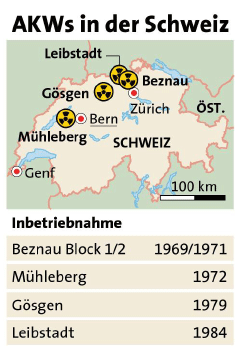
APA/M. Schmitt
Die Regierung geht dabei von einer Betriebsdauer von 50 Jahren aus - das erste AKW müsste demnach 2019 vom Netz, das letzte 2034. Diese Regierungsempfehlung wurde an das Parlament weitergeleitet, das vergangene Woche ebenfalls zustimmte. Der Schritt-für-Schritt-Ausstieg sei „technisch möglich und wirtschaftlich tragbar“, für eine vorzeitige Stilllegung gebe es aber keinen Anlass, hieß es dazu aus dem Schweizer Energieministerium.
Schwachstellen, aber sicher
Die Schweizer AKWs gelten im internationalen Vergleich als alt. Das erste Kraftwerk ging 1969 in Beznau ans Netz. Greenpeace Deutschland sprach aufgrund der häufigen Störanfälligkeit der Schweizer AKWs von einer „mangelnden Sicherheitskultur“. Der sichere Betrieb der AKWs sei derzeit gewährleistet, betonte die Regierung. Die Übergangszeit bis zum endgültigen Ausstieg könne nun für die Umsetzung einer neuen Energiepolitik genutzt werden.
Eine Sicherheitsüberprüfung durch das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI) vor wenigen Wochen hatte ergeben, dass alle fünf Schweizer AKWs trotz Schwachstellen bei der Lagerung von Brennelementen vorerst am Netz bleiben dürften. Sie müssen jedoch den Nachweis erbringen, dass sie gegen starke Erdbeben und Hochwasser gerüstet sind.
Strom sparen notwendig
Die volkswirtschaftlichen Kosten für den Umbau und für Maßnahmen zur Reduktion der Stromnachfrage belaufen sich nach ersten Berechnungen des Bundes auf 0,4 bis 0,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. In dieser Ausstiegsstrategie ist es auch notwendig, Strom zu sparen. Laut aktuellen Prognosen steigt die Stromnachfrage bis 2050 auf rund 90 Milliarden Kilowattstunden (2010: rund 60 Mrd. KWh). Um die fehlende Energiemenge zu kompensieren, sollen Wasserkraft und erneuerbare Energiequellen ausgebaut werden, notfalls ist auch der Import von Strom denkbar.

APA/Keystone/Martin Rütschi
Das älteste Schweizer AKW Beznau I und II von 1969/71.
Regierung gespalten
Einig war sich der Bundesrat, der sich aus den Vertretern aller großen Parteien zusammensetzt, nicht. Die sozialdemokratischen Vertreter und die bürgerliche BDP sprachen sich im Vorfeld für einen Ausstieg aus. Die rechtspopulistische SVP und die wirtschaftsfreundliche FDP galten lange als Atomkraftbefürworter. Hier fand ein Umdenken statt. Den Ausschlag dürfte auch Energieministerin Doris Leuthard von der christdemokratischen CVP gegeben haben. Sie hatte sich für einen „geregelten Atomausstieg“ ausgesprochen.
Links: