Kraft tanken und Kastanien sammeln
Mit Merkwörtern und Malreihen beginnt es schon in der Volksschule: das Lernen, Üben und Wiederholen – gar nicht so selten auch außerhalb der Schule, am Nachmittag und am Wochenende. Gerade Volksschulkinder brauchen dazu häufig noch Unterstützung der Eltern, zumindest in den halbtägigen Schulformen, die in Österreich immer noch dominieren.
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
Laut einer Umfrage der Arbeiterkammer, die Anfang Juni präsentiert wurde, brauchen fast zwei Drittel aller Schülerinnen und Schüler beim Lernen die Hilfe ihrer Eltern. Volksschüler benötigen laut AK die meiste Unterstützung: Hier berichten 86 Prozent der Eltern, dass sie nachmittags mit ihren Kindern lernen. Auch in Neuen Mittelschulen und AHS-Unterstufen helfen immer noch etwa drei Viertel der Eltern ihren Kindern beim Lernen.
Auch die Masse an Ratgeberliteratur erweckt den Eindruck, es sei Aufgabe der Eltern, sich als „Lerntrainer“ zu betätigen und täglich mit ihren Kindern den Lernstoff noch einmal durchzugehen: In zahlreichen Büchern können Eltern nachlesen, wie sie ihre Kinder „richtig coachen“ und wie der Lernerfolg „optimiert“ werden kann.
„Unterstützung schrittweise reduzieren“
Der größte Druck entstehe aus den Sorgen und Ängsten der Eltern um die formale Bildungskarriere ihrer Kinder, sagt Karl Dwulit, Vorsitzender des Österreichischen Verbands der Elternvereine an öffentlichen Pflichtschulen. Für Eltern wären daher mehr Informationen über die Ziele des Schuljahres und der Klasse hilfreich.
Eltern, die sich sorgen, dass ihr Kind nicht genug lernt oder auch die Leistung nicht erbringt, die die Eltern erwarten, gerieten oft unter Druck, sagt auch Gabriele Kulhanek-Wehlend, Institutsleiterin an der Pädagogischen Hochschule Wien. Ängste wie „aus meinem Kind wird nichts, wenn es nicht ins Gymnasium kommt“ und Befindlichkeiten wie „mein Kind ist hier schlechter als andere in der Klasse“ spielten sogar schon bei den Kleinsten eine Rolle.
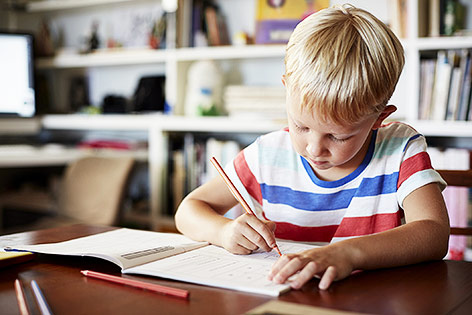
Getty Images/Morsa Images
Kinder müssen lernen, alleine zu lernen. Das dauert und erfordert von Eltern den Spagat zwischen Unterstützung und Zurückhaltung.
Doch wie viel elterliches Engagement ist zu viel? „Jüngere Kinder brauchen zu Beginn sicher noch Unterstützung der Eltern, da sie mit der für sie neuen Institution Schule samt ihren neuen Anforderungen erst vertraut werden müssen“, so Kulhanek-Wehlend. Diese sollte aber schrittweise reduziert werden. Die Rolle der Eltern sieht die Bildungsexpertin eher darin, dass sie mit dem Kind besprechen, ob alles erledigt ist, aber „keinesfalls darin, dass die Eltern die Arbeit der Kinder übernehmen“.
Hausübungen kontrollieren: Ja oder nein?
Oft führt allerdings das eine zum anderen: Vom Nachschauen, ob eine Ankündigung in der Mitteilungsmappe auf eine Unterschrift wartet, ist es nur ein kurzer Weg zum Buntstiftenachspitzen und dem Ausbessern von Fehlern in der Hausübung. Wenn Eltern die Hausübungen der Kinder auf Fehler kontrollieren, täten sie den Kindern wenig Gutes, so Kulhanek-Wehlend: „Erstens wird das Kind nicht verstehen, warum es sich dann noch bemühen soll – es wird ja sowieso alles ausgebessert -, und zweitens kann die Lehrerin oder der Lehrer so nicht erkennen, wo vielleicht Schwierigkeiten auftauchen, um dann dort ansetzen zu können.“
Nicht aus der Rolle fallen
„Interesse und Unterstützung anbieten, aber nicht aufdrängen" raten die Schulpsychologen des Bildungsministeriums. Wenn Eltern gegenüber ihren Kindern Interesse für ihre schulische Entwicklung zeigen, sei das sicherlich positiv, nicht förderlich sei hingegen, „wenn Eltern Prüfungen und Tests und die Vorbereitung darauf zu ihrem eigenen Anliegen machen und die Verantwortung dafür an sich ziehen“, heißt es aus der Abteilung für Schulpsycholgie im Bildungsministerium.
Und: Eltern sollten gegenüber Kindern in ihrer Rolle als Eltern bleiben und nicht die der Lehrkraft übernehmen. Die Schulpsychologen nehmen aber auch die Schule in die Pflicht: Es sei Aufgabe der Lehrkräfte, alle Schülerinnen und Schüler so zu unterstützen und die zu Hause zu erledigenden Arbeitsaufträge so zu formulieren, dass diese auch alleine bewältigt werden können.
Frage der Chancengleichheit
Zu lernen, wie man lernt, ist auch im Hinblick auf Gerechtigkeit im Bildungssystem eine wesentliche Frage. Denn nicht alle Eltern können ihre Kinder in der Unterrichtssprache Deutsch auf gleiche Weise unterstützen oder sich Nachhilfestunden leisten. Aufgabe des Bildungssystems ist es auch, benachteiligende Unterschiede, mit denen Kinder schon in die Schule kommen, auszugleichen.
In der Realität wird Bildung in Österreich aber immer noch vererbt, wie der Datenband „Bildung in Zahlen 2015/16“ der Statistik Austria erst Anfang Mai zeigte: Die Bildung der Eltern hat großen Einfluss darauf, ob ein Kind die Matura oder einen Hochschulabschluss erreicht. Die Schulpsychologen des Bildungsministeriums plädieren in diesem Zusammenhang für den Ausbau der Ganztagsschulen: „Hier könnten Kinder auch am Nachmittag optimal gefördert werden“. Auch die Familien würden durch ganztägigen Unterricht „wesentlich entlastet“.
Selbstständiges Üben in Unterricht einplanen
Eine bis zur achten Schulstufe gemeinsam und idealerweise ganztägig geführte Schule würde Familien mehr Zeit für gemeinsame Aktivitäten bringen, sagt auch Dwulit. Lehren und das Begleiten von Übungsphasen sei jedenfalls Aufgabe der Schule. Und auch für selbstständiges Üben müsse während des Unterrichts Zeit sein. Damit sich das alles ausgeht, müssten Lehrerinnen und Lehrer den Schultag entsprechend gestalten, so der Vorsitzende des Verbands der Elternvereine.
„Es spricht wenig dagegen, dass zu Hause Leseübungen und Gedichte abgehört werden oder im Rahmen eines Familienausflugs an Wochenenden Blätter oder Kastanien für den Sachunterricht gesammelt werden“, sagt Dwulit, aber in erster Linien sollten sich Schülerinnen und Schüler zu Hause erholen und Kraft tanken.
Links:
– Arbeiterkammer
– Verband der Elternvereine
– Pädagogische Hochschule Wien
– Schulpsychologie - Bildungsberatung (Bildungsministerium)