Von Karls „Hufe“ zum heutigen Huber
Karl der Große beflügelt die Fantasie: Nicht nur im 19. Jahrhundert, als man den Franken mit dem Stiernacken zur auch optisch mächtigen Kaiserfigur stilisierte - bis heute muss Karl als Symbolfigur herhalten, wenn es wie im Fall des Karlspreises um die Einheit Europas geht. Das Karolinger-Reich und Karl der Große seien wie geschaffen für historische Projektionen, sagt Historiker Karl Brunner - und erinnert dabei an übersehene Leistungen des Herrschers, der am 28. Jänner vor 1.200 Jahren starb.
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
Es ist das symbolische Jahr 800, das den überzeitlichen Glanz von Karl dem Großen festigt: Papst Leo III. kürt den König der Franken, der Karl nach dem Ableben seines Bruders Karlmann ab 771 war, zum Kaiser. Karl knüpft an die spätantike Tradition des Kaisertums an und vollzieht damit die Renovatio Imperii, also die Wiederherstellung des Römischen Reiches.
Die höchste weltliche Macht, das Imperium, ist durch Gottesgnadentum von den Römern auf die fränkischen Könige übergegangen. Eng verzahnt und mit Folgewirkung über Jahrhunderte hinweg sind damit weltliche Herrschaft und die Kirche. Als Patricius Romanorum ist der Kaiser der Schutzherr der Kirche. Jede militärische Expansion Karls, etwa die blutigen Sachsenkriege (772 bis 804), wird mit der Zwangschristianisierung der eroberten Gebiete verbunden sein.

APA/ORF.at
Das Neue am Kaiserreich Karls
Der Mittelalterexperte Brunner erinnert im Gespräch mit ORF.at daran, dass die Kaiserreichsidee Karls und seiner Vordenker durchaus neuartige Züge hatte und nicht zuletzt machttaktischen Erwägungen geschuldet war. „Eine der Schwierigkeiten des fränkischen Reiches ist, dass es eigentlich ein Vielvölkerreich ist - nicht nur zwischen einer romanischen und germanischen Kultur, sondern auch innerhalb dieser Kulturen“, so Brunner, der darauf verweist, dass die einzelnen Fürstentümer im Reich „weitgehend autonom“ gewesen seien: „Es ging darum, ein Herrschaftsinstrument zu entwickeln, wo man auf jeden Fall über den regionalen Gewalten steht.“
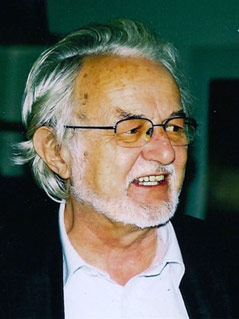
Maleczek
Mittelalterexperte Karl Brunner
Die Idee des Kaiserreichs sei gerade wegen der zahllosen Regionalkonflikte allen anderen Herrschaftsformen der Zeit überlegen gewesen. Umgekehrt, so Brunner mit Blick in die Neuzeit, habe das Kaisertum auf deutschem Boden wiederum der Kleinstaaterei Vorschub geleistet.
Für den renommierten Mittelalterexperten liegt die Erbschaft Karls des Großen weniger im politischen denn im kulturellen und auch administrativen Bereich. Eine große und auch in aktuellen Karl-Monografien übersehene Leistung bestehe in der Agrarreform Karls und der Schaffung eines neuen Standes: der Bauern.
Die Etablierung des Bauerntums
Der Aufbau einer Agrarstruktur und die Etablierung des Bauerntums seien etwas Neuartiges in der europäischen Geschichte, so Brunner. Eingeführt worden sei auch eine klar bemessene Agrarfläche, die „Hufe“ (im süddeutschen Raum auch „Hube“): „Die Größe der Hufe ist mit ungefähr 30 Joch bemessen, ernährt eine Kernfamilie mit Mägden und Knechten. Das ist eine Einheitsgröße“, so Brunner.
Die Hufenverfassung im Karolinger-Reich habe eine klare Trennung zwischen Bauern und Kriegern gebracht: „Der Bauer zieht nicht mehr in den Krieg, und die Krieger müssen mit den Pferden so viel trainieren, dass sie nicht mehr Landwirtschaft betreiben können. Dieses Modell setzt sich durch. Menschen, die heute Huber heißen, sind die, deren Name sich von der Einheit Hufe ableitet.“
Brunner erinnert daran, dass mit den Bauern eine neue Mittelschicht entstanden sei. „Der Bauer ist nicht Unterschicht, sondern Mittelschicht“, so Brunner. Noch nach dem Zweiten Weltkrieg habe man in Österreich, etwa im Mühlviertel, bäuerliche Strukturen vorgefunden, wo der größte Hof eines Ortes genau 30 Joch, die Größe der karolingischen Höfe, hatte.

Louvre/2000 RMN/Jean-Gilles Berizzi
Wie könnte Karl der Große ausgesehen haben? Im Mittelalter idealisiert man den Herrscher optisch weniger als später im 19. Jahrhundert. Hier eine Reiterstatuette, die man in der Kathedrale in Metz entdeckte und die heute im Louvre aufbewahrt wird.
Ein Kaiser und seine Föderalisten
Das fränkische Reich Karls müsse man sich grundsätzlich als ein Konglomerat an Personengruppen vorstellen, in dem viele adelige Gruppen ohnedies ihr eigenes Geschäft gemacht hätten. Zwar hätte es über die Funktion des Missus, also eines Gesandten in den einzelnen Grafschaften, so etwas wie den Versuch der Zentralverwaltung gegeben, Zugriff auf die lokalen Adelsgruppen zu bekommen. Doch diese lokalen Adelsgruppen hätten ohnedies das gemacht, was aus ihrer Sicht richtig gewesen sei.
„Das ist so wie der Streit zwischen der Zentrale Wien und den Föderalisten. Der Versuch, einen Staat im modernen Sinn zu bauen, gelingt nicht. Das Karolinger-Reich zerfällt nach Karl wieder.“ Es habe eine kulturelle Einheit gegeben, „faktisch politisch setzen sich aber die regionalen Einheiten durch“, so Brunner.
Europa rückt weg vom Mittelmeer
Folgenreich für die weitere Gestaltung des mittelalterlichen Europas sei, so Brunner, allerdings die Verlagerung der Machtzentren Europas weit nördlich der Alpen gewesen. Damit habe Europa den Zugriff auf das Mare Nostrum, das Mittelmeer, verloren - das ja immer auch so etwas wie eine Verbindungsklammer zwischen den verschiedenen Kulturen gewesen sei. Die islamische Eroberung des Mittelmeer-Raums unterstreicht für Brunner den fehlenden Zugriff auf das Mittelmeer.

Reuters
Karls Kaiserthron in Aachen - viele Politiker wie hier Bill Clinton und Gerhard Schröder pilgern an den symbolträchtigen Ort
„Karl der Große hat keine Flotte. Alle Innovationen in der Seefahrt werden im islamischen Bereich geschaffen“, sagt Brunner und ergänzt: „Ein Europa mit einem Herrschaftsbereich weit nördlich der Alpen sollte folgenreich sein für die weitere Entwicklung der europäischen Machtstrukturen. Und alle Generationen nach ihm hatten Probleme, die Entwicklungen in Italien zu koordinieren.“
Folgenreiches Gottesgnadentum
Karls Kaiserwürde ist durch das Gottesgnadentum abgesichert. Und als weltlicher Herrscher wird der Kaiser seinerseits die Entwicklung der Kirche stark prägen. In der Beurteilung der Leistungen der Regentschaft Karls zählt für den Historiker Brunner vor allem, „was beim Regieren von oben nach unten ankommt und was nicht“. Im kirchlichen Bereich erreiche Karl die zentrale Besetzung der Bistümer. Mehr noch: „Es gelingt, eine Sprache und eine Liturgie im ganzen Reich durchzusetzen. Die Struktur des Jahreskreises ist im Reichsevangeliar aufgesetzt.“
Der Kirche komme im Reich Karls fast so etwas wie die Rolle der Medien zu. Zudem würden die Klöster mit ihren Handschriften vieles überzeitlich festhalten. „Es gibt eine Kultur der Schriftlichkeit“, so Brunner, „die auch in den Hof hineinreicht und auch von Kirchenleuten dominiert wird. Wenn Karl einen seiner Vertrauten, Arn, nach Salzburg schickt und zum Erzbischof macht, ist für ihn gesichert, dass seine Ideen in weltlicher und geistlicher Hinsicht durchgesetzt werden - und dass seine Ansichten zu allen heiligen Zeiten gepredigt werden.“
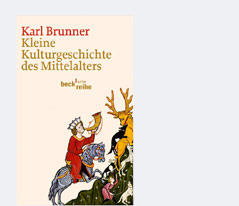
C.H.Beck
Buchhinweise
- Karl Brunner: Kleine Kulturgeschichte des Mittelalters. C. H. Beck, 269 Seiten, 14,95 Euro.
- Johannes Fried: Karl der Große. Gewalt und Glaube. Eine Biographie. C. H. Beck, 736 Seiten, 29,95 Euro.
Universelle Sprache, nachhaltiges Schriftsystem
Mit dem wieder aufgegriffenen Lateinischen habe man eine internationale Sprache zur Hand gehabt, die quer durch die verschiedenen Kulturen im Reich verstanden werden konnte. Und dass wir heute noch in Groß- und Kleinschreibung schriftlich kommunizierten, könne man auch als Erbschaft der Karolinger verstehen: „Es ist die karolingische Groß- und Kleinschreibung, die man zur Zeit der Renaissance zur Standardschrift erklärte, und letztlich haben wir sie heute noch mit der Groß- und Kleinschreibung.“
Brunner schätzt die kulturellen Leistungen der Zeit Karls des Großen nachhaltiger ein als die politischen Leistungen, so sehr Karl auch die politische Struktur Europas vorgezeichnet habe. Dass man noch aus der Gegenwart heraus so viel auf den Begründer der mittelalterlichen Kaiserreichsidee projiziert, kommentiert der Historiker nüchtern: „Es gibt bei Projektionssystemen die Sehnsucht nach einfachen Strukturen. Und das glaubt man im Karolinger-Reich zu finden.“
Gerald Heidegger, ORF.at
Links: