Jedem Jahrzehnt sein „heißes“ Thema
Mit ihrem rasanten Wachstumstempo sind China, Indien, Russland und Brasilien - die BRIC-Staaten - in den letzten Jahren zu einer Art Synonym für veränderte Gleichgewichte der Weltwirtschaft geworden: hier Krise, dort Boom scheinbar ohne Ende. Mittlerweile aber kristallisieren sich einige Probleme, mit denen diese Länder kämpfen, heraus. Mit dem Turbowachstum ist vorerst Schluss.
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
Die Zukunft der BRIC-Staaten und die anderer aufstrebender Schwellenländer war Thema einer Konferenz in Wien. Ruchir Sharma, Chefstratege für den Bereich Emerging Markets bei Morgan Stanley in New York, erklärte in seinem Referat die große Zeit der BRIC-Staaten als mehr oder minder beendet. Jedes Jahrzehnt habe sein „heißes Thema“, kaum eines bleibe allerdings länger „heiß“ als zehn Jahre. In den 1970er Jahren seien es Rohstoffe gewesen, in den 80ern Japan, vor dem Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000 Technologie, und zuletzt habe sich eben alles um die BRICs gedreht.
Gemeinsam sei solchen Zyklen, so Sharma, dass der Wert von Investments in den Boom-Sektor in den ersten zehn Jahren ganz massiv ansteige, in der zweiten Dekade aber in der Regel Verluste einfahre. „Und das ist genau das, was mit den BRICs gerade passiert“, weil sich ihr Wachstumstempo nämlich deutlich verlangsame. Verantwortlich dafür seien veränderte globale Rahmenbedingungen, aber auch lokale Probleme.

ORF.at/Georg Krammer
Ruchir Sharma: „Die BRICs waren die Story des letzten Jahrzehnts“
„Alle Rückenwinde flauen nun ab“
Der Boom, argumentierte Sharma, Autor des im Vorjahr erschienenen Bestsellers „Breakout Nations. In Pursuit of the Next Economic Miracles“, sei Ergebnis einer ganz bestimmten Konstellation gewesen. Ein starker Konsum etwa in den USA, eine florierender Welthandel und massive Investitionsflüsse in Richtung Schwellenländer hätten dazu geführt, dass diese eine rasante Entwicklung eingeschlagen hätten. „Alle diese Rückenwinde flauen nun ab.“ Westliche Banken scheuten zunehmend Kreditrisiken, dazu kämen spezifische strukturelle Probleme, „Verwerfungslinien“, die eigentlich ein Alarmsignal sein müssten.
Geht es nach Sharma, folgt das Auf und Ab der Wirtschaft generell einer Entwicklung, die er als „Lebenszyklus“ bezeichnet. Nur gerade nach oben - und das noch über Jahrzehnte - gehe es nie, schreibt der Analyst auch in seinem Buch zum „Mythos der langen Perioden“. Es wachse schlicht kein Baum in den Himmel – im Gegenteil.
Der „Lebenszyklus“ der Wirtschaft
Erfolg säe stets die Saat für „Arroganz und Selbstherrlichkeit“, sinngemäß vielleicht passender übersetzt als Trägheit und Reformfaulheit. Diese wiederum bereite den Boden für Krisen. Erst wenn es zu Krisen komme, so Sharma, würde der Reformweg eingeschlagen, der am Ende wiederum eine Erholung ermögliche. Laut dem Schema befinden sich Länder wie Indien in der Phase der Trägheit, andere, wie die Philippinen, aber auch Länder mit Reformeifer in Zentral- und Osteuropa (CEE), hätten gerade die Basis für den Wiederaufschwung gelegt.
Sharma hat, nicht nur das Modell BRIC-Staaten betreffend, überhaupt ein Problem mit Langzeitprognosen. Dabei laute das Motto anscheinend, seine Voraussagen so weit in die Zukunft hineinzulegen, dass sich später niemand mehr daran erinnern könne, dass man eventuell falsch lag. Ein ganz simpler, aber „der größte Fehler, den wir zu machen pflegen“, sei außerdem „der, zu extrapolieren“. Wenn es in einem Land ein Jahrzehnt lang laufe wie geschmiert, dann sei das noch lange kein Garant dafür, dass es so weitergeht.
Kein Baum wächst in den Himmel
Es gebe überhaupt nur zwei Länder auf der Welt, die über fünf Jahrzehnte ein Wirtschaftswachstum von fünf Prozent oder mehr pro Jahr über fünf Jahrzehnte hätten halten können - Südkorea und Taiwan. Eine These des BRICs-Konzepts von Goldman-Sachs-Chefökonom Jim O’Neill ist die, dass die Wirtschaftsleistung dieser vier Länder bis 2050 die der (früheren) Gruppe der G6 (Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, USA und Großbritannien) übersteigen würde.
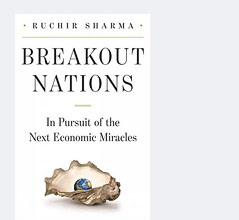
W. W. Norton & Company
Buchhinweis:
Ruchir Sharma: Breakout Nations. In Pursuit of the Next Economic Miracles. Penguin, 320 Seiten, 12,99 Euro.
Kritisch sieht der Emerging-Markets-Experte auch, wenn in Prognosemodellen stark unterschiedliche Länder in einem Topf landen. Nach den BRICs kamen die „Next 11“, dann die „CIVITS“ (für China, Indien, Vietnam, Indonesien, die Türkei und Südafrika) und andere Modelle, für Sharma allesamt „schicke Akronyme“ zu Marketingzwecken, aber kaum mehr, da die betreffenden Länder meist „essenziell nichts miteinander zu tun haben“.
Die Volkswirtschaften Chinas, Indiens, Brasiliens und Russlands sollen in diesem Jahr nach Prognosen des Internationalen Währungsfonds (IWF) um 7,6, 3,8, 2,5 bzw. 1,5 Prozent wachsen. Auch beim Argument, dass diese Zahlen im Vergleich zu denen in Europa und den USA immer noch teils astronomisch aussehen, hakt Sharma ein. Für Industriestaaten unerreichbar, fühlten sich vier oder fünf Prozent Wirtschaftswachstum „in Ländern wie Indien mit einem Pro-Kopf-Einkommen von 1.500 Dollar an wie eine Rezession“. Die Wachstumsraten sänken rascher, als man sich gedacht hätte.
Veränderte Vorzeichen und „Verwerfungslinien“
Grund seien neben der dem Ende zugehenden Ära des billigen Geldes eben die bereits genannten, spezifischen strukturellen Probleme, mit denen die vier größten Schwellenländer kämpfen: steigenden Schulden, Abhängigkeit von Rohstoffexporten, Währungsturbulenzen. China etwa habe, um sein Wachstumstempo zu halten, mittlerweile einen immensen Schuldenberg angehäuft. Vor fünf Jahren hätte es einen Dollar Schulden gekostet, um einem Dollar BIP-Wachstum zu schaffen, heute stehe das Verhältnis vier zu eins. Wenn Schuldenstand derart rasch steige, „führt das immer zu Schwierigkeiten“.
In Brasilien lasse das Wachstumstempo - ähnlich wie in Russland - wegen der starken Abhängigkeit beider Länder vom Rohstoffexport (bei sinkender Nachfrage) nach. Brasilien habe außerdem absolut versäumt, in seine Infrastruktur zu investieren, es fehle an Produktivität. Dasselbe gelte auch für Russland, nachdem der Staat dort zunehmend seine „schwere Hand“ auf die Wirtschaft gelegt habe. Indien kämpfe vor allem mit seiner irgendwann „explodierten“ Inflation samt Währungskrise. Trotzdem: Das Ende des BRICs-Booms, an das Sharma fest glaubt, ist für ihn keine Katastrophe, sondern eine Rückkehr „zur alten Normalität“, einem Wirtschaftswachstum von vier bis fünf Prozent pro Jahr wie vor der großen Euphorie.
Die Rückkehr Osteuropas
Andere Länder, die er „Breakout Nations“ nennt, könnten in den kommenden Jahren durchaus ein höheres Tempo an den Tag legen. Um zu beurteilen, welche das sind, zieht Sharma unterschiedlichste Kriterien - von politischen Rahmenbedingungen über die Staatsverschuldung und den Zustand des Industriesektors bis hin zur „Hubschrauberregel“ zum Zustand der Infrastruktur - heran.
Auf Basis dieser Überlegungen räumt er mittelfristig am ehesten Ländern wie den Philippinen, Thailand, Peru, Kolumbien, Mexiko, Polen und in weiterer Folge etwa „Frontier Markets“, der „nächsten Generation der Emerging Markets“, wie Laos und Kambodscha, Kenia und Nigeria, die größten Chancen ein. Außerdem rechnet er mit einer Erholung in CEE, nachdem die Länder dort „wirklich viel gelitten“ hätten.
„Growth Markets“ anstatt BRICs
Anna Stupnytska, Makroökonomin und Chefin des Asset Managements bei Goldman Sachs in London, verwies in ihrem Referat darauf, wie sehr die BRIC-Staaten die globale Wirtschaftslandkarte in den letzten Jahren tatsächlich verändert hätten. Das theoretische Modell zu kritisieren sei heute einfach, im Jahr 2001 (damals tauchten die BRICs als Begriff erstmals auf) hätte allerdings kaum jemand die weitere Entwicklung antizipiert, O’Neills Modell sei dagegen sehr knapp an die Tatsachen herangekommen.

ORF.at/Georg Krammer
Anna Stupnytska: "Chancen durch wachsende „globale Mittelklasse“
Heute teilt Goldman Sachs die Welt in die Industriestaaten, „Wachstumsmärkte“ („Growth Markets“, in diesen Kategorie fallen neben den BRICs auch Mexiko, Indonesien, Südkorea und die Türkei) und die (ebenfalls von O’Neill erdachten) „Next 11“. Unter ihnen finden sich zusätzlich noch Ägypten, Bangladesch, Nigeria, Iran, Pakistan, die Philippinen und Vietnam. Dabei handle es sich um Länder, denen man eine rasante Entwicklung zutraue. Das bedeute aber nicht, so Stupnytska, dass man dabei ein festes Schema im Kopf habe.
„Noch längst nicht vorbei“
Trotz des sinkenden Wachstumstempos, zeigte sie sich in ihrem Referat bei der von der Wirtschaftskammer veranstalteten Konferenz unter dem Titel „BRICs or Beyond?“ überzeugt, werde der Anteil der Emerging Markets allgemein an der globalen Wirtschaftsleistung in den nächsten Jahren weiter deutlich zunehmen. „Wachstum kommt von außerhalb der Industriestaaten (...), Wachstum kommt nicht aus Griechenland, es kommt nicht aus Italien.“
Mit dem Aufstieg der BRICs hätten sich Gesellschaften verändert, eine neue Mittelklasse sei aufgetaucht, und „da kommt noch viel mehr“. Bis 2030 könnte die „globale Mittelklasse“, glaubt Stupnytska, auf bis zu zwei Mrd. Menschen anwachsen. Das bedeute „Veränderungen beim Konsum, Veränderungen bei der Produktion“ und neue Chancen in Sektoren wie etwa Tourismus und Dienstleistungen. „Das ist der Teil der Geschichte, der längst noch nicht vorbei ist.“
Georg Krammer, ORF.at
Links: