In den Schuhen des Teufels
Mit seinem 6.000 Seiten umfassenden Monumentalwerk „Kriminalgeschichte des Christentums“ hat sich Karlheinz Deschner den Ruf erworben, der bedeutendste Kirchenkritiker unserer Zeit zu sein. Jetzt liegt der zehnte und letzte Band vor.
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
„Gott geht in den Schuhen des Teufels“, schrieb Deschner in seinem Nachwort des ersten Bandes. Der Satz skizziert schon, was der Autor über seinen Gegenstand zu sagen hat. Den Widerspruch zwischen den hohen moralischen Ansprüchen des Christentums und den schrecklichen Tatsachen, die dessen reale Umsetzung in der Welt hervorbrachte, aufzuzeigen: Das kann man ohne Übertreibung als Deschners Lebenswerk bezeichnen.
Die Arbeit von 50 Jahren
Schon 1970 begann Deschner mit der „Kriminalgeschichte des Christentums“, deren erster Teil erst 16 Jahre später erschien. Insgesamt arbeitete Deschner 50 Jahre an der Reihe, die er nun in seinem 88. Lebensjahr abschloss. Nebenbei schrieb er noch zahlreiche andere Bücher, darunter auch einige Romane, von denen sich der Großteil ebenfalls um die Themen Christentum und Verbrechen dreht.
Der vorliegende letzte Band beginnt mit den religiös motivierten Kriegen im Skandinavien der Neuzeit. Danach folgt ein Abriss über das orthodoxe Christentum und Russland, allen voran die Schandtaten Ivans des Schrecklichen. Der Niedergang des Papsttums in der Neuzeit und die Trennung von Staat und Kirche im 18. Jahrhundert markieren das Ende des Bandes und somit auch der gesamten „Kriminalgeschichte des Christentums“. An ihre zehn Bände schließt thematisch die bereits 1991 erschienene „Politik der Päpste im 20. Jahrhundert“ an.
Wie schon in den Vorläuferbänden trieft auch der letzte Band mit dem Titel „18. Jahrhundert und Ausblick auf die Folgezeit“ vor Blut, eine Fülle furchtbarer Gräueltaten wird aufgezählt. Leise Töne sind Deschners Sache nicht: „Foltern, pfählen, köpfen, beten oder ‚Laßt uns alle einig sein in christlicher Liebe!‘“, heißt ein Kapitel im zehnten Band der „Kriminalgeschichte“.
Opportunismus, Anstacheln, Ausbeutung
Anders als man erwarten könnte, ist die „Kriminalgeschichte des Christentums“ nicht ausschließlich Anklage gegen die christlichen Kirchen selbst, auch wenn sie in Form von Mitläufertum, Anstacheln und Bemänteln der schlimmsten Untaten ausführlich angeprangert werden. Auch die Verbrechen, die sich im weiteren Sinn gegen das siebente Gebot „Du sollst nicht stehlen“ richteten wie der im Kirchenstaat geradezu systemimmanente Nepotismus und die Ausbeutung der Armen, finden Erwähnung.
Die Verschränkung von Regierungen und Staaten mit der Kirche beschreibt Deschner als unheilvolles, grundlegendes Übel. Doch eigentlich geht es dem Autor um die christliche Gesellschaft in ihrer Gesamtheit, die Taten frömmelnder, demonstrativ gläubiger Herrscher und Mächtiger, und so könnte seine Reihe über weite Strecken auch „Kriminalgeschichte der christlich geprägten westlichen Zivilisation“ heißen.
Prinz Eugen als Muster an Grausamkeit
Lustvoll geht der Autor daran, den Mythos des „edlen Ritters“ Eugen von Savoyen zu demontieren. Dieser über Jahrhunderte als leuchtendes Vorbild für „christliche Werte“ gepriesene, überaus erfolgreiche Heerführer (seine Kriegserfolge halfen dabei, das damalige Habsburgerreich zu verdreifachen) wird von Deschner als eiskalter Machtmensch gezeichnet. Kriegstreiberei statt Heldentum, Geldgier statt Bescheidenheit, Grausamkeit statt Humanismus: Hier werden die immer noch gern zitierten „christlichen Werte“ am Beispiel des Prinzen Eugen in ihr Gegenteil gewendet vorgeführt.
Deschners Pazifimus und seine geradezu heilige Wut gegen alles, was mit Krieg zu tun hat, scheinen deutlich durch die schaurigen Fallbeispiele durch. Seine besondere Anteilnahme gilt den „kleinen Soldaten“, die von ihren frommen Monarchen und Heerführern in den vielen Schlachten der Neuzeit als billiges Kanonenfutter missbraucht und hunderttausendfach geopfert wurden.
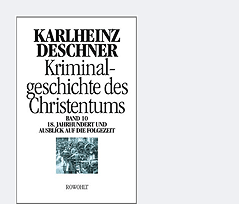
Rowohlt
Buchhinweis
Karlheinz Deschner: Kriminalgeschichte des Christentums, Band 10. 18. Jahrhundert und Ausblick auf die Folgezeit. Rowohlt, 320 Seite, 23,60 Euro
Blumiger Schreibstil
Dass Deschner schon mangelnde Wissenschaftlichkeit und Objektivität vorgeworfen wurden, kann man stellenweise verstehen. Doch seine Bücher sind allesamt genau recherchiert und in wissenschaftlicher Manier mit (nicht allzu vielen) Fußnoten versehen. Sein blumiger Schreibstil und seine häufigen leidenschaftlichen Zwischenrufe (und die gelegentlichen Rufzeichen) mögen nicht jedem gefallen, klar ist aber: Hier schreibt sich jemand etwas vom Herzen. Dabei bleibt Deschner, Freund von Schriftstellern wie Hans Henny Jahnn und unter anderem Träger des Arno-Schmidt-Preises, immer auch Literat.
So liest sich die „Kriminalgeschichte“ leicht und unterhaltsam, etwa über den Machtverlust der katholischen Kirche: Noch im 17. Jahrhundert habe Urban VIII. gedroht, immerhin „12.000 Mann ins Feld zu werfen, (...) während im 18. Jahrhundert Benedikt XIV. nur noch über wenige Tausend Streiter gebot, deren Dienstplan nach dem Wecken mit dem Rosenkranzbeten begann“.
Hier ist wirklich kein kühler, objektiver Historiker am Werk: „Legenden und Lügen schießen nur so ins christliche Kraut“, heißt es da etwa. An anderer Stelle ist gar von einem „Pfaffenslogan" die Rede. So schließt Deschner auch in seiner Nachbemerkung mit Nachdruck und unversöhnlich: „Das Christentum wurde der Antichrist. Jener Teufel, den es an die Wand malte: er war es selber! Jenes Böse, das es zu bekämpfen vorgab: es war es selber! Jene Hölle, mit der es drohte: sie war es selbst!“
Johanna Grillmayer, ORF.at
Links: