Kühle Annäherung an „Hitlers Henker“
Wie wenige andere verkörpert Reinhard Heydrich den Nazi-Terror. Als „Hitler’s Hangman“ („Hitlers Henker“) wurde er in Großbritannien bezeichnet. Unter diesem Titel hat der Historiker Robert Gerwarth die Biografie Heydrichs geschrieben, die nun auf Deutsch vorliegt. Gerwarth räumt dabei mit einigen Mythen auf - und zeigt, wie Heydrich nicht zuletzt in Österreich 1938 Schlüsselerfahrungen machte, die seine Haltung gegenüber Juden prägten.
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
War Reinhard Tristan Heydrich, Sohn aus musisch-bürgerlichem Haus und ehemaliger Marineoffizier, ein fanatischer Nazi-Ideologe oder wie oft beschrieben ein eiskalter Vernichter ohne Überzeugungen? An seiner Person hat sich über Jahrzehnte hinweg ein eigenwilliges Faszinosum entwickelt. Zahlreiche Künstler von Heinrich Mann („Lidice“, 1942) über Fritz Lang/Bert Brecht („Hangman, also die“, 1943) bis zu Laurent Binet („HHhH“, 2010, ausgezeichnet mit dem Prix Goncourt) haben sich an der Gestalt Heydrich abgearbeitet - gleichzeitig aber zahlreiche Mythen am Leben erhalten.
Rivalitäten und Revierkämpfe
Mit nüchternem Blick erzählt nun der Historiker Robert Gerwarth, Professor für moderne Geschichte am University College Dublin, die zahlreichen Wandlungen Heydrichs, die nach seinem Eintritt in die SS in den frühen 1930er Jahren nicht zuletzt auch den Revierkämpfen und Rivalitäten mit anderen Nazi-Größen geschuldet sind.
Gerwarth zeigt, wie stark inhaltliche Positionierungen, gerade auch hinsichtlich der Judenpolitik, taktischen Erwägungen im Machtgefüge im Umfeld Hitlers geschuldet waren. Gleichzeitig entlastet Gerwarth mit diesem soziologischen Ansatz Heydrich nicht, sondern belegt, wie sehr sich Heydrich seit seiner Verlobung mit der überzeugten Nationalsozialistin Linda von Osten sehr wohl auch ideologisch mit dem Nazi-Rassismus identifizierte.
Gerücht über jüdische Wurzeln
Immer wieder fühlte sich Heydrich, wie Gerwarths Buch genau darstellt, von der Andeutung verfolgt, selbst jüdische Wurzeln zu haben - und immer wieder wird genau dieses Gerücht, etwa in der Rivalität zwischen Heydrichs Sicherheitsdienst und dem Geheimdienst des Heeres unter seinem ehemaligen Gönner Wilhelm Canaris, eine Rolle spielen und gegen Heydrich ins Spiel gebracht.
Hintergrund der Gerüchte über die angebliche jüdische Abstammung Heydrichs ist ein Artikel eines ehemaligen Schülers von Heydrichs Vater Bruno, Martin Frey, der für den Beitrag über den Opernsänger und Musikschulleiter Bruno Heydrich in „Hugo Riemanns Musik-Lexikon“ die zweite Ehe von Bruno Heydrichs Mutter mit Gustav Robert Süß, einem protestantischen Schlossergehilfen, ins Spiel brachte.
Es war der Name Süß, der die Assoziation zur jüdischen Herkunft weckte. Dass Heydrichs Vater gegen diesen Artikel prozessierte, ist für den Zeithistoriker Gerwarth kein „Beleg für Bruno Heydrichs radikalen Antisemitismus als vielmehr ein Hinweis auf das allgemeine politische Klima, in dem der ‚Vorwurf‘, ein jüdischer Unternehmer zu sein, als geschäftsschädigend empfunden wurde“.
Heydrichs zunehmende Radikalisierung
Seit seinem Eintritt in die SS, die der arbeitslose Ex-Marineoffizier und seine Familie wie eine existenzielle Rettung empfanden, und nach dem Aufstieg zum Leiter des Sicherheitsdienstes (SD) radikalisierte sich Heydrichs Haltung auf verschiedenen Ebenen, nicht zuletzt in der Judenfrage.

AP
Heinrich Himmler, Förderer Heydrichs, mit Heydrich 1938 in Wien
Das Vorgehen gegen die Juden sollte für Heydrich zu einer Nazi-internen Karrierefrage werden. Bereits vor dem Krieg ließ Heydrich, der seinen Überwachungsapparat zunehmend perfektionierte, Informationen über jüdische Einrichtungen zusammentragen. Mit einem System aus Enteignung und Deportation sollten die Juden aus dem Reich gedrängt werden.
Die Erfahrungen beim „Anschluss“
Zentrale Schritte in der Judenpolitik der Nazis unternahm Heydrich infolge der Erfahrungen rund um den „Anschluss“ Österreichs. Heydrich war einer der Ersten aus der Bürokratie Hitlers, die am 13. März 1938 in Wien ankamen. Gemeinsam mit SS-Führer Heinrich Himmler landete er um 5.00 Uhr in der Donaumetropole.
Hitler hatte, wie Gerwarth erinnert, „Himmler mit der Aufgabe betraut, die polizeiliche Kontrolle über das annektierte Gebiet zu sichern. Wie gewöhnlich reichte Himmler diesen Auftrag an Heydrich weiter, dem es damit oblag, die erste Verhaftungswelle zu leiten und die österreichische Polizei zu ‚säubern‘.“
Richtungsweisende Entscheidungen
Im Wiener Hotel Regina fallen wenige Tage später richtungsweisende Entscheidungen: Ernst Kaltenbrunner, der Führer der österreichischen SS, wird neuer Staatssekretär für Sicherheit, deutsche Polizisten sollen die heimische Exekutive „verstärken“ (was sich ob der Integrationsbereitschaft der österreichischen Polizeikräfte als nicht notwendig herausstellen sollte), und Heydrich ordnet die erste große Verhaftungswelle an. Am Abend des 13. März hatte Heydrich bereits eine weitere Operation durchführen lassen: die Konfiszierung jüdischen Eigentums.
SS entgleiten die Aktionen
In der neuen Stapo-Leitstelle in Wien muss Heydrich aber auch die beschlagnahmten Dokumente systematisch registrieren lassen, wie Gerwarth erinnert. Plünderungen und unkontrollierter Terror hätten, so Gerwarth, neben den „‚kontrollierten‘ SS-Polizeiaktionen“ um sich gegriffen. NS-Propagandaminister Joseph Goebbels notiert in sein Tagebuch: „Heyderich (immer falsch geschrieben, Anm.) hat einige sehr unliebsame Exekutionen in Österreich vollziehen lassen. (...) Heyderich wird nicht so leicht damit wegkommen.“

Corbis/Hulton-Deutsch Collection
Erniedrigung der jüdischen Bevölkerung in Wien 1938
Ungezügelte Gewalt gegen Juden
Womit Heydrich bei seinen Anordnungen nicht gerechnet hatte: mit dem Terror, der sich ungezügelt gegen die 170.000 in Wien lebenden Juden richtete. „Das Maß der gegen sie gerichteten Gewalt ging deutlich über alles hinaus, was seit 1933 an antisemitischen Ausschreitungen im Altreich stattgefunden hatte“, erinnert Gerwarth. Bereits in den ersten Stunden des deutschen Einmarsches sei es in Österreich zu Überfällen auf Juden und Plünderungen jüdischer Geschäfte gekommen.

AP
Adolf Eichmann: Im Auftrag Heydrichs baut er in Wien die Zentralstelle für jüdische Auswanderung auf
„Die pogromartigen Exzesse in Österreich drohten die ‚geordneten‘ Aktionen der Gestapo zu sprengen und Heydrichs Autorität zu untergraben“, so Gerwarth. Heydrich stellte ein spezielles SD-Kommando aus „Judenexperten“ zusammen, darunter Herbert Hagen und der in Linz aufgewachsene Adolf Eichmann.
„Gewaltgeschwängerte Atmosphäre“
Das Kommando wurde aber laut Gerwarth bei der Durchführung seines Auftrags „massiv behindert“, etwa „durch die wilden Aktionen der eigenen Anhänger, die in der gewaltgeschwängerten Atmosphäre Wiens und anderer österreichischer Städte außer Rand und Band gerieten“. Immer wieder ermahnte Heydrich seine SS-Männer dazu, willkürliche Gewaltexzesse gegen die Juden zu unterlassen. Heydrich gab nach den Erfahrungen in Österreich gar einen allgemeineren Erlass für den gesamten Polizei- und SD-Apparat heraus.
„Bei der Vertreibung der Juden aus dem öffentlichen Leben gingen die österreichischen Nationalsozialisten auf eine Art und Weise vor, die die Methoden im Altreich vor 1938 weit in den Schatten stellte“, schreibt Gerwarth.
Heydrich und die November-Pogrome
Symptomatisch scheint dem Biografen die gespaltene Haltung Heydrichs zu den November-Pogromen, für welche die Ermordung des deutschen Botschaftssekretärs in Frankreich, Ernst von Rath, durch den jungen Juden Herschel Grynszpan als Anlass diente. Heydrich befand sich in Wien und ergriff am Abend des 9. November 1938 im Alten Rathaus das Wort. Wenn es zu „spontanen“ Ausschreitungen gegen Juden komme, so übersetzte er einer Wiener Öffentlichkeit eine Rede Goebbels vom selben Abend, dann werde die Polizei nicht eingreifen.
Einmal mehr wurde die SS, wie Gerwarth schreibt, von der Entfesselung und dem Ausmaß des Pogroms überrascht. Auch wenn Heydrich dem Pogrom etwas „Positives“ habe abgewinnen können, durften die Übergriffe nicht entgleiten, wollte er seine Position in der NS-Nomenklatur sichern. Zu Hilfe sollte Heydrich ein Bericht von Herbert Hagen über die Arbeit der Zentralstelle in Wien kommen, der am 12. November 1938 bei einer Besprechung im Reichsluftfahrtministerium Görings diskutiert wurde. Die „Kostenneutralität“ der Zentralstelle (die Juden mussten ja ihre Auswanderung selbst bezahlen und ihre Enteignung billigen) wurde als Argument für Heydrichs Vorgangsweise herausgestrichen.
Schlüsselrolle in NS-Judenpolitik
Mit der Einrichtung der Reichszentrale für jüdische Auswanderung orientierte sich die Nazi-Spitze an Heydrichs in Wien entwickeltem Enteignungsmodell und sicherte ihm zugleich eine Schlüsselrolle in der Judenverfolgung. Mit großer Sachlichkeit zeigt Gerwarth auch die weiteren Schritte in der Judenpolitik Heydrichs: von den Plänen einer Deportation nach Madagaskar bis zum Auftrag Görings, alle Maßnahmen zur „Gesamtlösung der Judenfrage“ zu treffen. Heydrich war der Organisator der Wannsee-Konferenz im Jänner 1942, bei der die Pläne zur Deportation und Ermordung der Juden in Osteuropa finalisiert wurden.
Heydrichs Ende: Die Aktion „Anthropoid“
Vier Monate nach der Wannsee-Konferenz wurde Heydrich, der zugleich als stellvertretender Reichsprotektor von Böhmen und Mähren installiert wurde, um den als zu wenig hart eingeschätzten Konstantin von Neurath zu kontrollieren, Opfer eines Attentats. Dem aus der Slowakei stammenden Josef Gabzik und dem Tschechen Jan Kubis gelang am 27. Mai 1942 im Rahmen der in London organisierten Operation „Anthropoid“ ein Anschlag mit einer Handgranate auf den offenen Wagen Heydrichs.
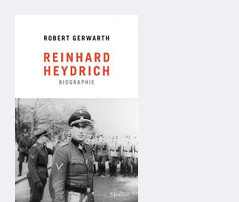
Siedler Verlag
Buchhinweis
Robert Gerwarth: Reinhard Heydrich. Aus dem Englischen von Udo Rennert. Siedler Verlag, 480 Seiten, 30,90 Euro.
Heydrich starb an einer durch die Granatsplitter verursachten Sepsis - Penizillin wurde damals erst in England eingesetzt und stand in Deutschland nicht zur Verfügung. Noch während der „Henker des Dritten Reiches“ (Thomas Mann) mit dem Leben rang, ließ Hitler einen Vergeltungsbefehl für das Attentat ergehen. Die Dörfer Lidice und Lezaky wurden dem Erdboden gleichgemacht, alle Männer Lidices über 15 erschossen, die Frauen in Konzentrationslager deportiert.
Eine Biografie, die mit dem Tod beginnt
Gerwarth behandelt den Tod Heydrichs gleich zu Beginn seiner Biografie. Er lässt ihn sterben, bevor noch von seiner Geburt erzählt wird. Gerwarth zeigt, ohne zu werten, wie Heydrichs Taten stets immer im Kontext des Machtgefüges und in Zusammenhang mit Machtkämpfen innerhalb des NS-Regimes erfolgten.
Immer wieder schneidet Gerwarth auch die Familiengeschichte der Heydrichs und die gesellschaftlichen Kontakte innerhalb der NS-Führungsschicht mit den machtpolitischen Aktionen gegen. „Es gab Momente, wo ich die Arbeit am liebsten abgebrochen hätte“, sagte Gerwarth in einem Interview. Gleichzeitig besteht der Historiker auf der kritisch-nüchternen Distanz und möchte die „Rolle des Historikers nicht mit der eines Staatsanwalts bei einem Kriegsverbrecherprozess verwechseln“. Gerwarth gelingt eine Annäherung an das System Heydrich innerhalb des Machtgefüges des Nazi-Regimes. Die Person Heydrich, so das Fazit nach über 400 Seiten Lektüre, bleibt nach wie vor unfassbar.
Gerald Heidegger, ORF.at
Links: