Der „direkte Weg nach unten“
Vor fünfzig Jahren hat sich Sylvia Plath, Schriftstellerin und Ikone der Frauenbewegung, das Leben genommen. Nur wenige Wochen zuvor wurde ihr einziger Roman veröffentlicht. „Die Glasglocke“ wurde in den 1970er Jahren zum Kultbuch und wird nun in der Übersetzung von Reinhard Kaiser neu aufgelegt.
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
Ihren Status als Ikone habe ihre Mutter nur deshalb erlangt, weil sie mit dem aufsehenerregenden Selbstmord Schlagzeilen gemacht habe, beklagte ihre Tochter Frieda Hughes viele Jahre nach dem Tod Plaths. Und tatsächlich - auch wenn Literaturwissenschaftler sich über die Qualität ihres autobiografischen Romans einig sind, wäre er wohl ohne ihren Selbstmord kaum zu einem Schlüsselroman ihrer Zeit geworden.
„Es war ein verrückter, schwüler Sommer, dieser Sommer, in dem die Rosenbergs auf den elektrischen Stuhl kamen und ich nicht wußte, was ich in New York eigentlich wollte.“ Schon im ersten Satz des Romans legt Plath die Ebenen, auf denen sich die Beobachtungen und Erlebnisse ihres literarischen Alter Ego Esther Greenwood abspielen werden, fest. Die Ich-Erzählerin wirkt im ersten Moment wie eine völlig durchschnittliche amerikanische Studentin kurz vor dem College-Abschluss. Und doch entpuppt sich die nur scheinbar heile Welt als Fassade, die Depression, an der Esther leidet, schiebt sich immer weiter ins Bild.
Achterbahnfahrt der Gefühle
So wird Plaths Roman, der bei seinem Erscheinen unter anderem mit J. D. Salingers „Fänger im Roggen“ verglichen wurde, eine Achterbahnfahrt der Gefühle auf den Spuren der bipolaren Störung. Authentisch vermittelt sich die Zerrissenheit der Autorin, die für ihre Emotionen mit geradezu traumwandlerischer Sicherheit literarische Bilder erfinden konnte.
„Ich fühlte, wie sich meine Lunge unter dem Ansturm der Landschaft blähte - Luft, Berge, Bäume, Menschen. Ich dachte: ‚So fühlt man sich, wenn man glücklich ist.‘“ Das Bild der Skifahrerin, die „den direkten Weg nach unten“ nahm, zeigt etwa deutlich, was die „Glasglocke“ für die Protagonistin und damit für Plath selbst bedeutete: die Unfähigkeit, Glück zu empfinden, bei dem gleichzeitigen Wunsch, den Gefühlen, die rundum so bestimmend zu sein scheinen, nachzufühlen.
Die Unfähigkeit, sich zu entscheiden
Das wohl meistzitierte Beispiel ist Plaths Metapher des Feigenbaums, zwischen dessen Früchten sich Esther nicht entscheiden kann - und will. „Gleich dicken, purpurroten Feigen winkte und lockte von jeder Zweigspitze eine herrliche Zukunft.“ In der „Glasglocke“ sind die so verlockenden und einander widersprechenden Zukunftsaussichten Symbol für die Entscheidung der Frau zwischen Familie und Karriere. Esther ist eine Frau, die beides will und damit unfähig ist, eine Entscheidung zu treffen. „Wenn es neurotisch ist, dass man zwei Dinge, die sich gegenseitig ausschließen, gleichzeitig will, dann bin ich allerdings verdammt neurotisch.“
Esther ist fremd im glamourösen Leben, das sie als Praktikantin bei einer New Yorker Frauenzeitschrift leben soll - Partys, Fotoshootings, Modeschauen, Oberflächlichkeit. Aber auch zurück in der Provinz kann sie sich nicht mit der Aussicht, ein Leben als 1950er-Jahre-Hausfrau zu führen, abfinden, aus Angst, „dass Heiraten und Kinderkriegen wie eine Gehirnwäsche war und dass man nachher nur noch benebelt herumlief, wie ein Sklave in einem totalitären Privatstaat“.
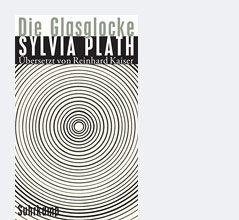
Suhrkamp
Buchhinweis
Sylvia Plath: Die Glasglocke. Suhrkamp Verlag, 262 Seiten, 19,99 Euro
„Die Welt selbst“ als „böser Traum“
Derart zurückgedrängt in ihr eigenes Universum wird Esther mehr und mehr zur Beobachterin ihres eigenen Lebens, „unter der gleichen Glasglocke in meinem eigenen sauren Dunst“. Der „böse Traum“ ist dabei „die Welt selbst“, der sie durch Selbstmordversuche zu entfliehen versucht.
Genau wie ihre Protagonistin unternahm Plath nach dem Ende ihrer Zeit in New York einen Selbstmordversuch und wurde anschließend in einer Klinik stationär behandelt. Später konnte sie ihr Studium in Cambridge fortsetzen, wo sie ihren Ehemann Ted Hughes - ebenfalls Lyriker - kennenlernte. Er war es auch, dem später alle Welt die Schuld am Selbstmord seiner Frau gab. Jahrelang stand sie in seinem Schatten, stets schien sie - so belegen ihre Tagebuchaufzeichnungen, ihre Gedichte und auch ihr Roman - mit dem Anspruch an sich selbst zu hadern.
Nachdem Hughes Plath betrogen und verlassen hatte, nahm sich Plath am 11. Februar 1963 das Leben - nur drei Wochen nachdem die „Glasglocke“ unter dem Pseudonym Victoria Lucas erschienen war. Vom durchschlagenden Erfolg ihres Romans und ihrer Lyrik, von ihrem Status als Ikone der Frauenbewegung hat sie nie erfahren. Das, was ihrer Protagonistin am Ende des Buchs gelingt, blieb Plath verwehrt: „wie von einem Zauberfaden“ gelenkt aus der Glasglocke hervorzutreten und ins Leben zurückzukehren.
Links: