Nachhaltigkeit derzeit kein Thema
Spätestens seit den Selbstmorden beim chinesischen Apple-Zulieferer Foxconn wird auch in der IT-Branche über bessere Arbeitsbedingungen diskutiert. Für komplett fair produzierte Smartphones, Gadgets und Computer braucht es aber mehr als einen gut bezahlten Arbeitsplatz - etwa „konfliktfreies“ Zinn.
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
Die niederländische Forschungsinstitution Waag Society hat 2010 damit begonnen zu erforschen, wo die unterschiedlichen Materialien für technische Geräte tatsächlich herkommen. Mitte 2012 wurde die Idee geboren, ein Produkt mit möglichst fair produzierten Materialien zu bauen, um der Idee auch ein Gesicht zu geben und die Herstellungsschritte dahinter aufzuzeigen. Im September 2013 sollen nun die ersten FairPhones auf den Markt kommen.
Zinn finanziert Krieg mit
Zinn wird für die Verbindung elektronischer Bauteile, etwa auf Platinen, eingesetzt. Platinen sind die Nervenbahnen jedes elektronischen Geräts, auf ihnen wird etwa der Arbeitsspeicher angebracht. Der Abbau erfolgt unter anderem in der Demokratischen Republik Kongo, wo trotz des offiziellen Endes des Bürgerkriegs weiterhin gekämpft wird. Weil Geld aus dem Zinnabbau direkt in die Taschen der lokalen Warlords fließt, finanzieren Computer und Smartphones den Krieg dort mit.
Im Vordergrund stehen dabei vor allem faire Produktionsbedingungen, so Joe Mier, Sprecher der FairPhone-Initiative, gegenüber ORF.at. Denn vollständig fair im eigentlichen Sinne des Gedankens - Produktion und Handel ohne Ausnutzung einer Seite - werden diese Geräte vorerst nicht sein. „Ein Telefon kann nie zu 100 Prozent fair sein“, so Mier, dazu bestehe es aus viel zu vielen Einzelteilen. Erst wenn alle einzelnen Teile wirklich „fair“ sind, kann das gesamte Gerät als „fair“ bezeichnet werden. Mehr als dreißig verschiedene Mineralien und Metalle stecken in einem durchschnittlichen Smartphone - mehr dazu in fm4.ORF.at.
Aufmerksamkeit erhöhen
Zwar gebe es Zinn, das im Rahmen der Conflict-Free Tin Initiative in der Demokratischen Republik Kongo „ohne Blut“ abgebaut werde, aber für viele andere Materialien gebe es solche Projekte noch nicht. Gold etwa wird zwar auch „fair“ angeboten, vorerst kommt dieses aber nur in der Schmuckproduktion zum Einsatz.

Reuters/Finbarr O'Reilly
Zinnabbau in einer Mine in der Demokratischen Republik Kongo
FairPhone selbst geht es in erster Linie auch gar nicht darum, ein komplett „konfliktfreies“ und „faires“ Handy auf den Markt zu bringen, sondern die Aufmerksamkeit für das Thema zu erhöhen. Dazu sollen die FairPhones wie die meisten technischen Geräte ebenfalls in Asien erzeugt werden, allerdings unter fairen Produktionsbedingungen, sprich die Arbeiter sollen gute Arbeitsbedingungen und eine ebensolche Bezahlung erhalten.
Diskussion über „fairen“ Produktionsort
Dass die erste „faire“ Computermaus in Deutschland zusammengebaut wird, hat Nager IT, der Initiative dahinter, auch Kritik eingebracht. So könnte die Situation der Arbeiter in Asien nie verbessert werden, wenn Geschäfte von dort abgezogen werden, lautete der Vorwurf. Schließlich würden in China durch die Nachfrage auch Arbeitsplätze entstehen. Nager IT argumentiert, dass die Einhaltung und Überwachung westlicher Standards in Asien auch aufgrund kultureller Unterschiede sehr schwierig ist, gerade für kleine Projekte.
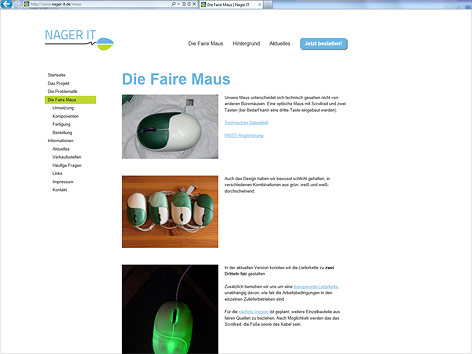
Screenshot von nager-it.de/maus
Die Faire Maus von Nager IT
Auch die Maus von Nager IT ist nicht komplett „fair“ in Bezug auf die verwendeten Materialien und die Arbeitsbedingungen. Laut Angaben wird etwa das Gehäuse „ohne Ausbeutung“ produziert, das Kabel und die Linse stammen jedoch aus unbekannter Quelle. Mit der Zeit sollen alle Bauteile aus fairer Produktion bezogen werden, das werde aber einige Jahre dauern. Dieser Initiative geht es ebenfalls vor allem um Aufmerksamkeit für das Thema, daher wurde ein relativ einfaches Gerät ausgesucht, das aus wenigen Bauteilen besteht.
Transparenz und Offenheit als Zielsetzung
Zu wie viel Prozent das erste FairPhone wirklich „fair“ sein wird, wollte Mier nicht beantworten. Im ersten Schritt wolle sich die Organisation vor allem auf die Arbeitsbedingungen konzentrieren. Die Technologie werde von Partnern lizenziert, als Betriebssystem kommt in der ersten Version wohl Android zum Einsatz. Später sollen dann Firefox OS und Ubuntu OS eine Option sein, wobei auf die Unterstützung eines Parallelbetriebs von zwei SIM-Karten viel Wert gelegt wird.
FairPhone
Die technischen Details sollen im Mai mit dem Prototypen veröffentlicht werden. Zwischen 250 und 300 Euro soll ein FairPhone kosten, die Einnahmen sollen wieder in das Projekt investiert werden.
Eines der FairPhone-Ziele ist, das Produkt wie auch das Projekt selbst möglichst offen zu halten - dazu gehört unter anderem, dass Benutzer das Gerät selber öffnen und modifizieren können, wenn sie das möchten. Ein weiteres Ziel ist, dass das Handy recycelt und wiederverwendet werden kann. Von den ersten 10.000 Stück wurden bisher über 5.000 vorbestellt, von niederländischen Hackern bis deutschen „Bio-Hausfrauen“ reicht laut Mier das Zielpublikum.
„Fair Trade braucht Zeit“
Ob FairPhones auch abseits der einschlägigen Zielgruppen gekauft werden, wird sich zeigen. Bisherige Versuche, fair produzierte oder nachhaltigere Geräte zu vermarkten, schlugen fehl. Derzeit gebe es viel Echo für das Projekt, so Mier, der aber auch zugibt, dass das Siegel „fair“ alleine für den Verkauf womöglich nicht ausreicht - hipp müsse ein Gerät auch sein. „Fair Trade braucht Zeit, aber die Konsumenten wollen meist nicht warten“, so Mier.
Bei der Diskussionsreihe twenty.twenty von „The Gap“ und A1 gab Konsumentenschützerin Daniela Zimmer von der Arbeiterkammer Mitte Februar in Wien zu bedenken, dass vor allem Jugendliche ihr Handy als Statussymbol sehen, was von der Werbung auch noch entsprechend befeuert werde. „Wir haben es verabsäumt, einer Generation beizubringen, dass Geräte auch halten können“, so Zimmer weiter. Oft werde von Servicestellen auch nicht repariert, sondern gleich ausgetauscht - und die Idee des kurzen Produktzyklus so weiter manifestiert.
Links: