Ein Tiroler Querdenker
Mehrere Kirchen, Schulen, Jugendzentren und zahlreiche Wohnbauten: Der 2000 verstorbene Josef Lackner gilt als einer der bedeutendsten Architekten der österreichischen Nachkriegsgeneration. In diesem Jahr wäre der Tiroler 80 Jahre alt geworden - ein Jubiläum, das das Architekturzentrum Wien (AzW) zum Anlass nimmt, ihn mit der Ausstellung „Josef Lackner_Wohnlandschaften“ zu würdigen.
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
Wie viele Architekten hatte Lackner nach seinen ersten Erfolgen durchaus Ambitionen für eine internationale Karriere. Dennoch kehrte er nach Lehrjahren in verschiedenen Architekturbüros in Deutschland in seine Heimat Tirol zurück. Dort habe er sich, so Friedrich Achleitner in der Zeitschrift „architektur aktuell“, zu einer Art „Über-Ich“ der Architekten entwickelt - „nicht nur durch die Maßstäbe, die er durch seine Bauten gesetzt hat, sondern auch durch seine Wortmeldungen, meist nicht zur Freude der Betroffenen, denn seine Kritik traf den Nagel immer auf den Kopf, wenn auch häufig der Hammer für den Nagel viel zu groß war“.
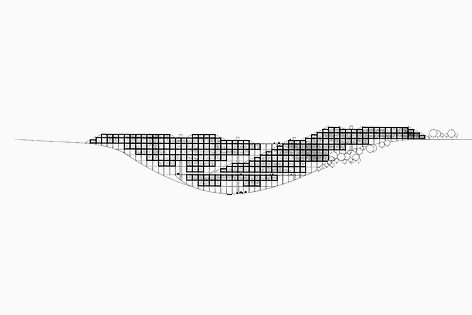
Architekturzentrum Wien
Vorschlag für die Siedlungsform „Antistadt“, 1967, Projekt Moos, Schweiz
Unter dem Einfluss der klassischen Moderne
Lackners erste Arbeiten der 1960er Jahre entstanden noch unter dem Einfluss der Klassischen Moderne, gleichzeitig setzt sich der Architekt bereits kritisch mit den Planungsrealitäten seiner Zeit auseinander. Gemeinsam mit Johannes Spalt, Johann Georg Gsteu, Friedrich Kurren, Gustav Peichl und anderen studierte der Tiroler bei Clemens Holzmeister an der Akademie der bildenden Künste Wien. Im Vergleich zu vielen seiner Kollegen blieb Lackner jedoch ein Einzelkämpfer.
Der Großteil seiner Bauten steht in seiner Heimat Tirol und zeichnet sich vor allem durch ihren herben Charme, ihre feine Intelligenz und ihren oft zeichenhaften Auftritt aus. Vor allem sein Hang zum Querdenken und der radikalen Besinnung auf die fundamentale Grammatik der Architektur machen ihn bis heute zu einem prägenden Vorbild der Nachkriegsarchitektur - ein Status, der Lackner durchaus bewusst war, wie man aus vielen seiner Zitaten herauslesen kann. „Das, was ich so gemacht habe, hat eigentlich niemand wollen. Man hat es auf keinen Fall erkannt. Es waren immer Erstbesteigungen“, so der Architekt.
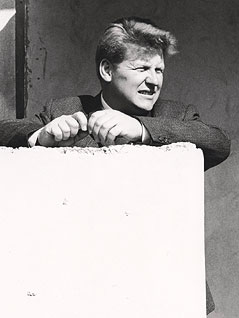
Architekturzentrum Wien
Ausstellungshinweis
Josef Lackner_Wohnlandschaften, AzW im MuseumsQuartier, 15. September bis 3. Oktober, täglich 10.00 bis 19.00 Uhr.
Auseinandersetzung mit Wohnsituationen
Gleich mehrere Projekte, wie die Wohnanlage Kaiser-Max-Straße in Hall in Tirol und die Wohnanlage B85 in Innsbruck, bezeugen seine intensive Auseinandersetzung mit der großstädtischen Form des Wohnblocks. Wabenartige Strukturen und große Fenster - zur optimalen Nutzung von natürlich einfallendem Tageslicht - gelten als klassische Elemente des Lacknerschen Oeuvres.
Die „Antistadt“ von 1967, die der Architekt für Moos in der Schweiz entwarf, wird als kritischer Beitrag gegen die funktionalen Großstadtentwicklungen verstanden. Nach dem Motto „Der Architekt muss Wohnungen planen, in denen er auch selbst gern wohnen möchte. Alles andere ist nicht erlaubt“, plante Lackner jedoch nicht nur Wohnanlagen, sondern auch zahlreiche Einfamilienhäuser.
"Autistische Introvertiertheit
Doch auch der Sakralbau spielt eine wichtige Rolle im Werk Lackners. Sein erster Entwurf für die Kirche St. Pius X. in Innsbruck stieß beim für den Bau zuständigen Bischof wegen seiner „autistischen Introvertiertheit“ zuerst auf Entsetzen, erklärte Arno Ritter vom Architekturforum Tirol in einem Beitrag des Onlineportals Detail.de über Lackner.
„Zu wenig Tageslicht“, hätte die Kritik an dem Bau gelautet, der als anti-hierarchisches Kirchenmodell geplant war. Lackner soll daraufhin ohne viele Umschweife die Ecken des Kartonmodells abgeschnitten haben und so die heute sichtbaren Fenster eingefügt haben.
Links: