Ein Kauz als Bonvivant
Max Frisch kann ohne Übertreibung als einer der wichtigsten deutschsprachigen Schriftsteller der Nachkriegsjahre bezeichnet werden. Seine Bücher sind bis heute fixer Bestandteil des Unterrichts in den allermeisten Gymnasien. Von seinem Roman „Homo faber“ wurden über drei Millionen Exemplare gedruckt, von der Niederschrift des Theaterstücks „Andorra“ sogar mehr als vier Millionen.
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
Diesen Sonntag wäre Max Frisch 100 Jahre alt geworden. Volker Hage, der im Jubiläumszirkus mit zwei Veröffentlichungen vertreten ist, interviewte den Schweizer Schriftsteller, als dieser 70 Jahre alt war. Auf die Frage nach der Bedeutung des Erfolgs erhielt er eine lapidare Antwort: „Der nimmt den Zweifel nicht weg.“ Einen steten Zweifel, der das Leben und Werk des Autors kennzeichnete.
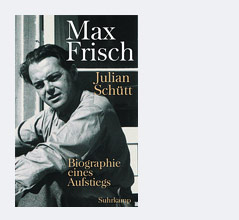
Suhrkamp Verlag
Buchhinweis
Julian Schütt: Max Frisch. Biographie eines Aufstiegs. Suhrkamp, 592 Seiten, 25,60 Euro.
Hadern mit dem Schreiben
Schon als junger Bursche verspürte Frisch den Drang zu schreiben. Sein erstes Drama verfasste der 1911 Geborene im Alter von 16 Jahren, nachdem seine Liebe zum Theater erwacht war. Deshalb entschied er sich auch für das Studium der Germanistik - von dem sich der unstete Charakter aber schon nach kurzem enttäuscht abwandte, weil man dort nichts lernte, was sich unmittelbar für den Beruf des Schriftstellers verwerten ließ.
Frisch sattelte auf Architektur um, einen Beruf, den er von seinem Vater kannte. Als dieser starb, verdiente sich der Student seinen Lebensunterhalt nebenher mit dem Schreiben feuilletonistischer Artikel, mit denen er vor allem bei der „Neuen Zürcher Zeitung“ Erfolge feierte. Auch weitere Theaterstücke und ein Roman entstanden, sein literarisches Schaffen fand zunehmend Beachtung. Dennoch entschied sich Frisch zunächst gegen ein Leben als Schriftsteller und kündigte sogar mehrfach an, überhaupt nicht mehr schreiben zu wollen, was ihm allerdings nicht gelang, zu weit war die Sucht fortgeschritten.
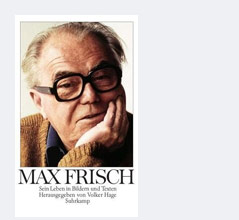
Suhrkamp Verlag
Buchhinweis
Volker Hage (Hrsg.): Max Frisch. Sein Leben in Bildern und Texten. Suhrkamp, 259 Seiten, 25,60 Euro.
Versuch eines bürgerlichen Lebens
Es folgten von 1941 an dreizehn prägende Jahre (relativ) bürgerlichen Lebens. Mit einer Studienkollegin bekam er drei Kinder, den Familienunterhalt bestritt er als Architekt mit eigenem Büro. Der einzige nennenswerte Erfolg in diesem Beruf war der Auftrag, ein riesiges Freibad in Zürich zu bauen. Seine Mitarbeiter, schreibt Volker Weidermann in seiner neuen, launig geschriebenen Biografie, sollten ihm später vorwerfen, nur die Schriftstellerei im Kopf gehabt zu haben. In seiner Freizeit schrieb Frisch Theaterstücke am laufenden Band.
Julian Schütt, der eben ein Buch über Frischs Aufstieg als Literat veröffentlichte, schreibt darin, dass ein Lehrling, der im Architekturbüro gearbeitet hatte, später in einem Brief süffisant die Nachlässigkeit Frischs als Lehrherr und die unfaire Entlohnung dem Einsatz des Autors für Gerechtigkeit in der Gesellschaft gegenüberstellte. Frisch, bereits 80 Jahre alt, antwortete, leugnete nichts und entschuldigte sich rundweg.
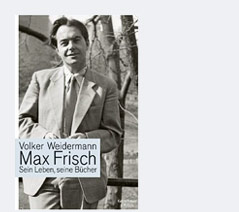
Kiepenheuer & Witsch
Buchhinweis
Volker Weidermann: Max Frisch. Sein Leben, seine Bücher. Kiepenheuer & Witsch, 407 Seiten, 23,60 Euro.
Notorischer Fremdgänger
Dann jedenfalls folgte der große Umschwung: Frisch schrieb den Roman „Stiller“, der ihm beachtlichen Erfolg und Bekanntheit im ganzen deutschsprachigen Raum bescherte. In dem Roman behaupten alle Figuren, eine Person zu kennen, die Stiller heißt - nur dieser Mann selbst leugnet, Stiller zu sein. Eine zentrale Rolle spielt in dem Buch auch die Beziehung Stillers (oder Eben-nicht-Stillers) zu seiner Ehefrau Julika. Volker Weidermann widerspricht Volker Hage, der von einem Buch der Liebe spricht, und nennt es im Gegenteil einen entschiedenen Abgesang auf die Ehe. 1954 jedenfalls erscheint der Roman - und Max Frisch verlässt seine Familie.
Wie brüchig die Fassade des bürgerlichen Lebens längst geraten war, zeigt ein Brief, den Frisch an seinen Verleger Siegfried Unseld schrieb. Darin lässt er sich über die Gemeinheit seiner Frau aus, die beim Scheidungsprozess eine „fast vollständige“ Liste seiner Ehebrüche vorgelegt hatte. Frisch mochte mit seiner Pfeife, der dicken Hornbrille und seinem gedrungenen Äußeren wie ein Kauz gewirkt haben - in Wahrheit war er Bonvivant und kein verschrobener Einzelgänger. Legendär ist seine spätere, turbulente Beziehung mit Ingeborg Bachmann.

rororo
Buchhinweis
Volker Hage: Max Frisch. Rororo Monographie, 160 Seiten, 9,30 Euro.
Zeit der Abrechnung
Ein Jahr nach der Trennung von seiner Familie hängte Frisch auch seinen Beruf als Architekt endgültig an den Nagel - der Erfolg von „Stiller“ hatte ihm ein regelmäßiges Einkommen verschafft. In „Homo faber“ (1957) rechnet Frisch mit der Gesellschaft und nicht zuletzt mit sich selbst ab. Ein seelenloser Techniker, der nicht an Gefühle glaubt und meint, gegen Schicksalsschläge gefeit zu sein, weil er sich alle Vorgänge rational erklären könne, wird von Frisch auf eine Tour de Force des emotionalen Grauens geschickt.
Zuerst die Notlandung eines Flugzeugs in der Wüste, dann die leidenschaftliche Beziehung mit einer attraktiven jungen Frau, die sich zuerst als seine Tochter herausstellt und dann bei einem tragischen Unfall stirbt, an dem der Mann nicht unbeteiligt ist, und schließlich seine eigene Krebserkrankung: Der Technokrat wird in Grund und Boden gestampft. Zufall, Schicksal, Fantasie und Gefühle müssen das Leben mitbestimmen dürfen, wenn nicht, ist der Weg ins Verderben vorgegeben.
„Weißeln, weißeln, weißeln“
Diesen Weg verließ Max Frisch und widmete sich neben Reisen und seinen wechselnden Beziehungen fortan nur noch dem Schreiben. Was seinen Erfolg betrifft, ging es nach „Homo faber“ Schlag auf Schlag. 1958 feierte er mit „Biedermann und die Brandstifter“ Erfolge. Dort bekommt ein „Haarölfabrikant“ im wahrsten Sinne des Wortes als Spießer sein Fett ab. Die Figur lehnte Frisch an einen Auftraggeber aus Architektenzeiten an, der gegen ihn einen Prozess geführt hatte.
Radiohinweis
Auf Ö1 sind zahlreiche Beiträge zu Max Frisch zum Nachhören und Nachlesen - darunter eine Reportage aus seinem zeitweiligen Wohnort, dem Dorf Berzona - mehr dazu in oe1.ORF.at.
1961 folgte „Andorra“, in dem Frisch sich mit Themen wie Antisemitismus und Mitläuferschaft auseinandersetzte. Jedes Jahr „weißeln“ die Bürger darin ihre Häuser - und hinter den leuchtenden Fassaden fault die Gesellschaft vor sich hin. Ein Roman („Mein Name sei Gantenbein“) sowie weitere Erzählungen und Theaterstücke folgten, ehe der Autor im Jahr 1991 kurz vor seinem 80. Geburtstag starb. Von seinem Freund Bertolt Brecht unterscheidet ihn, darin sind sich die Biografen einig - und auch er selbst bestand stets darauf -, dass Max Frisch in seiner Kritik an den Verhältnissen keine Antworten gab, sondern Fragen stellte. Und die haben sich gehalten, Tausende Maturanten können das Jahr für Jahr bestätigen.
Simon Hadler, ORF.at
Links: