Unstetes Leben, ausuferndes Werk
Der deutsche Schriftsteller Hans Fallada, ein Genie, ein Zweifler und ein Trinker, hat in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein unstetes Leben geführt, das Stoff für mehrere Filme bieten würde. Der Umgang mit seinem Werk ist nicht weniger spektakulär, damals wie heute.
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
Nun liegt nach seinem aufsehenerregenden, um 60 Jahre verspäteten Erfolg in den USA, Großbritannien und Israel Falladas Meisterwerk „Jeder stirbt für sich allein“ auch auf Deutsch in einer neuen Fassung vor - und zwar erstmals ungekürzt und unzensuriert. Der Berliner Aufbau Verlag hatte die Gesamtrechte am Werk Falladas (1893 - 1947) im vergangenen Jahr gekauft und weitere Publikationen angekündigt.
Fallada, ein Experte für das Leben der von ihm so genannten „kleinen Leute“, erzählt darin die wahre Geschichte eines Berliner Ehepaars, das nach dem Kriegstod seines Sohnes den Widerstand gegen die Nazis wagt und schließlich hingerichtet wird. Das Buch - laut der Ö1-Sendung „Ex Libris“ spannend wie ein Krimi - erschien kurz nach dem Tod des alkohol- und drogenkranken Autors in einer gekürzten, veränderten Version - mehr dazu in oe1.ORF.at.
Den Auftrag für den Text hatte Fallada kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges durch Vermittlung seines Freundes, des späteren DDR-Kulturministers Johannes R. Becher, vom Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands erhalten.
Heldengeschichte verweigert
Der Kulturbund bestellte damals Romane über Widerstandskämpfer bei verschiedenen Autoren. Falladas erster, über 800 Seiten langer Entwurf, wie bei ihm nicht ungewöhnlich in nur vier Wochen niedergeschrieben, entsprach aber nicht den Vorstellungen der Auftraggeber. Sein Porträt der Familie Hampel (im Roman heißt sie Quangel) fiel zu differenziert aus. Herr und Frau Quangel waren, das entspricht den historischen Fakten, zunächst selbst aktive und überzeugte Nationalsozialisten. Erst nach dem Kriegstod ihres Sohnes wandten sie sich in Antikriegs- und Anti-NS-Flugblättern an die Bevölkerung.
Dadurch wurde das heroische Bild der beiden, die doch nur aus politischen, nicht aber aus persönlichen Gründen gegen Hitler sein sollten, wie es die spätere DDR-Geschichtsschreibung wollte, angekratzt. Zudem kam der kommunistische Widerstand in dem Buch nicht gut weg. Mit äußerster Brutalität sei man gegen Abweichler innerhalb der Gruppe vorgegangen, schrieb Fallada. Der Kulturbund ließ also alle entsprechenden Stellen glätten.
„Roman vor Drucklegung ausbügeln“
Der Leiter des Aufbau Verlags, Kurt Wilhelm, schrieb damals an Fallada: „Es ist vielleicht ganz gut, wenn wir die eine oder andere in Betracht kommende Stelle im Roman vor Drucklegung ausbügeln, denn man soll nicht unnötig den Rezensenten der Zeitungen zu einer billigen Kritik verhelfen.“ (Zitiert nach einem Onlineartikel des NDR). Fallada erreichte dieser Brief schon nicht mehr, er war in der Zwischenzeit, am 5. Februar 1947, in einer Entzugsklinik an einem Herzinfarkt (nicht durch eine Überdosis ausgelöst) gestorben.
Nun gibt der Aufbau Verlag erstmals die Originalfassung heraus. Grundlage ist ein erst kürzlich im Verlagsarchiv entdecktes Manuskript, aus dem die damaligen Änderungen ersichtlich sind. Der Originaltext wird durch ein Nachwort, ein Stichwortverzeichnis und Dokumente zum zeithistorischen Kontext ergänzt.
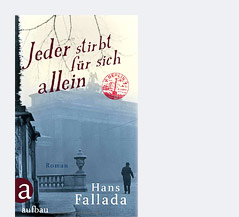
Aufbau Verlag
Buchhinweis
Hans Fallada: Jeder stirbt für sich allein. Aufbau Verlag, 704 Seiten, 20,60 Euro.
„Das beste Buch“
Der Schriftsteller Primo Levi, ein Überlebender von Auschwitz, nannte Falladas Roman „das beste Buch, das je über den deutschen Widerstand geschrieben wurde“. Im englischsprachigen Raum erlebte die Anti-Nazi-Geschichte kürzlich 60 Jahre nach ihrer Entstehung eine beispiellose Karriere.
Nach der Wiederentdeckung durch den US-Verleger Dennis Johnson, der im Interview mit dem Nachrichtensender n-tv angibt, von der „Wortgewalt“ des Schriftstellers ungemein beeindruckt gewesen zu sein, wurden in Amerika seit 2009 über 150.000 Exemplare verkauft, in Großbritannien sogar mehr als 300.000. Auch in Frankreich und Israel ist das Buch ein Bestseller. Die zuletzt im Ausland erschienenen Ausgaben stützen sich jedoch auf die gekürzte Fassung.
Biografie eines Getriebenen
Falladas Rezeptionsgeschichte ist also denkbar turbulent. Aber auch er selbst war zeit seines Lebens ein Getriebener. Vom Vater, der sich einen Juristen als Sohn wünschte, war er schon von Kindheit an heruntergemacht worden. Als 17-Jähriger plante er gemeinsam mit einem Freund einen als Duell getarnten Doppelselbstmord. Der Freund kam ums Leben, Fallada überlebte schwer verletzt, wurde wegen Unzurechnungsfähigkeit vom Vorwurf des Mordes freigesprochen und kam in psychiatrische Behandlung.
In den darauffolgenden Jahren wurde Fallada zum Trinker, immer wieder war er auch von Drogen abhängig. Es kam zu Gefängnisaufenthalten, weil er im Zuge seiner wechselnden Tätigkeiten, etwa als Gutsverwalter, Geld unterschlug, um seine Sucht zu finanzieren.
Nachdem er bereits drei Bücher geschrieben hatte, gelang Fallada 1932 mit „Kleiner Mann - was nun?“ der Durchbruch als Schriftsteller. Von Zeugen eines Gesprächs wurde er 1933 bei den Nazionalsozialisten als deren Gegner vernadert. Fallada beschränkte sich daraufhin geflissentlich auf sozialkritische Literatur, die die Nationalsozialisten nicht direkt angriff, und vor allem spannungsgeladene Unterhaltungsromane.
Eine düstere, hoffnungslose Welt
1944 wurde Fallada in eine geschlossene Heilanstalt für „geisteskranke Kriminelle“ eingewiesen, nachdem er im Streit mit seiner Frau einen Schuss auf sie abgegeben hatte (er traf nicht). Während seiner Haft schrieb Fallada in nur 16 Tagen seinen später gefeierten Roman „Der Trinker“, ein Buch, das bis heute als Meilenstein in der Beschreibung von Sucht- und Rauscherfahrungen gilt. Ebenfalls im Gefängnis schrieb er heimlich ein viel beachtetes Tagebuch, in dem er sich unter Lebensgefahr explizit gegen die Politik der Nationalsozialisten aussprach.
Auch dieses Werk wurde 2009 vom Aufbau Verlag unter dem Titel „In meinem fremden Land“ neu aufgelegt. Fallada teilt darin in alle Richtungen aus, wie „Die Berliner Literaturkritik“ schreibt. So kritisiert er jene scharf, die wegen der Nationalsozialisten Deutschland verlassen hatten: „Wir haben ausgehalten, sie aber nicht.“ Mitunter schlug er aber auch befremdlich antisemitische Töne an: „(...) ein kleiner degenerierter Jude (...)“
Links: