Von WikiLeaks zu Woodrow Wilson
Einen geschichtlich geschulten Blick auf die Debatte über WikiLeaks empfiehlt der Historiker Karl Schlögel. Er bezieht sich auf die Veröffentlichung diplomatischer Geheimdokumente und empfiehlt eine Debatte darüber, wie sehr persönliche Kontakte in Verbindung mit Diskretion für ein friedliches Auskommen nötig sind. Den großen Angriff auf die Geheimdiplomatie hätten vor WikiLeaks bereits die Bolschewiki und die USA nach dem Ersten Weltkrieg geführt.
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
US-Präsident Woodrow Wilson, so Schlögel, sollte genannt werden, wenn man versuche, die Rolle von WikiLeaks-Gründer Julian Assange in einem historischen Kontext zu betrachten. „Die Vorstellung, dass mit den Botschaftsmitteilungen (die WikiLeaks veröffentlicht hat, Anm.) irgendetwas ans Tageslicht gekommen ist, die ist ja irgendwie kindlich“, meint Schlögel im Gespräch mit ORF.at.
Man sollte, so Schlögel, genauer auf die Revolution in der Diplomatie nach dem Ersten Weltkrieg schauen. Schlögel selbst widmete dem in seinem (zurzeit vergriffenen) Buch „Das Russische Berlin: Ostbahnhof Europas“ (1998) ein ausführliches Kapitel und verwies dabei etwa auf die Rolle des britischen Diplomaten und Politikers Harold Nicolson („The Evolution of Diplomacy“, 1954), der an den Friedensverhandlungen 1919 mitgewirkt hatte.
Revolutionärer Gestus
„Die beiden Revolutionsmächte der Zeit, die Vereinigten Staaten und die Bolschewiki, hatten als gemeinsame Parole den Kampf gegen die Geheimdiplomatie der alten Mächte. Woodrow Wilson war Teil einer Avantgarde im Niederreißen der Geheimdiplomatie“, so Schlögel: „Man hat alle Dokumente, alles, was man herausgeben konnte, herausgegeben, also nichts anderes gemacht als WikiLeaks heute.“

Dontworry unter cc-by-sa
Die Erzählung der Geschichte
Zentrales Anliegen der Arbeit Karl Schlögels, der in dieser Woche auf Einladung des Instituts für die Wissenschaften vom Menschen in Wien war, sind Überlegungen zu Aufarbeitung und Darstellung historischer Ereignisse.
Es sollte das Ende der Geheimdiplomatie sein, das Ende der Kabinettspolitik, der Herstellung von Öffentlichkeit und der Demokratisierung der Außenpolitik, erinnert Schlögel dabei auch an das berühmte 14-Punkte-Programm Wilsons, in dem es ja gleich zu Beginn heißt: „Diplomatie soll aufrichtig und vor aller Welt passieren.“ Der Kampf gegen die Geheimdiplomatie sei eine alte revolutionäre Haltung. Diese Haltung ist ja auch bei den Bolschewiki zu finden, schaut man etwa auf den Titel eines Artikels von Lew Kamenew, der bereits im Genfer Exil Mitarbeiter Lenins war, in der „Prawda“ vom Frühjahr 1917: „Ohne Geheimdiplomatie“ stand über dem Artikel, der die Losung „Ohne Geheimdiplomatie für die revolutionäre Vaterlandsverteidigung gegen das Deutsche Reich“ transportierte.
Diplomatie als Kulturtechnik
Für Schlögel ist entscheidend, die Diplomatie zunächst einmal als „kulturellen Komplex“ zu begreifen: „Der Austausch zwischen Staaten kommt nicht aus ohne das Persönliche. Insofern hat der Gestus von WikiLeaks etwas kulturstürmerisches, weil es einen Bereich tangiert, ohne den das Zusammenleben auf der Welt noch nicht möglich ist. Nämlich dass es kein Auskommen gibt ohne das Gespräch auch hinter verschlossenen Türen und dass die Diskretion eine ungeheure Errungenschaft unserer Zivilisation ist.“
Es gebe nun einmal keine „Öffentlichkeit per se in einem fundamentalistischen Sinn“. Eigentlich, so Schlögel, müsste sich die Diskussion darum drehen, wo die Grenze verläuft „zwischen Diskretion als einer kulturellen Errungenschaft und Geheimdiplomatie als zweifelhafter Geheimbereich des Regierens“.
Neue Herausforderungen für Historiker
Für Schlögel stehen Historiker in der Gegenwart jedenfalls, wie auch das Beispiel WikiLeaks zeige, vor neuen Herausforderungen. Schlögel, der in der Geschichtsaufarbeitung die Elemente Raum und Zeit miteinander verbinden will und dabei immer wieder auf Karten verweist, von denen die „Geografie der Macht“ ablesbar sei, sieht nach dem 11. September 2001 die Notwendigkeit, die neuen, scheinbar unsichtbaren Grenzen darzustellen.
Die Grenzsperren des einstigen Eisernen Vorhangs, „mit diesen brachialen Einrichtungen“, seien „ja eigentlich nur transformiert worden, einerseits in viele kleine Grenzen, andererseits in Grenzen, die ebenfalls auf Installationen beruhen: Es gibt Überwachungskameras, Infrarotkameras, Satelliten.“
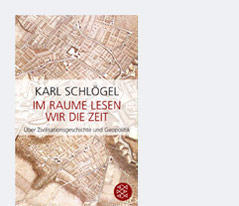
S. Fischer Verlag GmbH
Buchhinweis
Schlögel machte sich bereits 2005 mit „Im Raum lesen wir die Zeit" (zuerst Hanser, mittlerweile auch als Fischer-Tb vorliegend) für eine Erzählung von Geschichte stark, die Zeit und Ort miteinander in Verbindung setzt. An einem Ort und zu einer Zeit fänden sehr oft widersprüchliche Bewegungen statt, die Historiker immer in das Muster des Wenn-dann gezwängt hätten.
Die neue Kontrolle der Grenzüberschreitung
„Es gibt ein hochgerüstetes Netz von Schwellen und Schleusen, es gibt Situationen der systematischen Kontrollen und Durchleuchtungen. Hier geht es nicht darum, eine Bewegung von hier nach dort aufzuhalten, sondern Leute mit verschiedenen Identitäten zu identifizieren“, erläutert Schlögel. Und auch dieses neue System richte sich auf die Kontrolle der "Grenzüberschreitungen“.
Dennoch ließen sich diese neuen Räume, die durch Gesetzesnormen oder Kriminalitätsnormen zustande kämen, topografisch fixieren: „Man braucht dafür eine Matrix auf der Höhe des 21. Jahrhunderts, die nicht mehr mit alten Kontrollinstanzen rechnet. Es gibt im Grunde keinen öffentlichen Raum, der nicht dauernd im Blick ist und erfasst wird.“ Man müsste schon in der Schule lernen, die Sinne an einer Wirklichkeit zu schulen, die sich ständig weiterentwickle.
Schlögel zeigt sich aber auch überzeugt, dass der überwachte öffentliche Raum weiter „Bewegungen“ ermögliche, „die diesen Raum durchkreuzen“: „Die Kontrolle ändert nichts daran, dass man diesen Raum durchkreuzt. Die Auseinandersetzung mit WikiLeaks zeigt ja nur, dass Auseinandersetzungen in ganz andere Räume und Medien verlegt werden, und uns wird noch Hören und Sehen vergehen, welche Austragungsformen von Konflikten da noch auftauchen.“
Gerald Heidegger, ORF.at
Links: