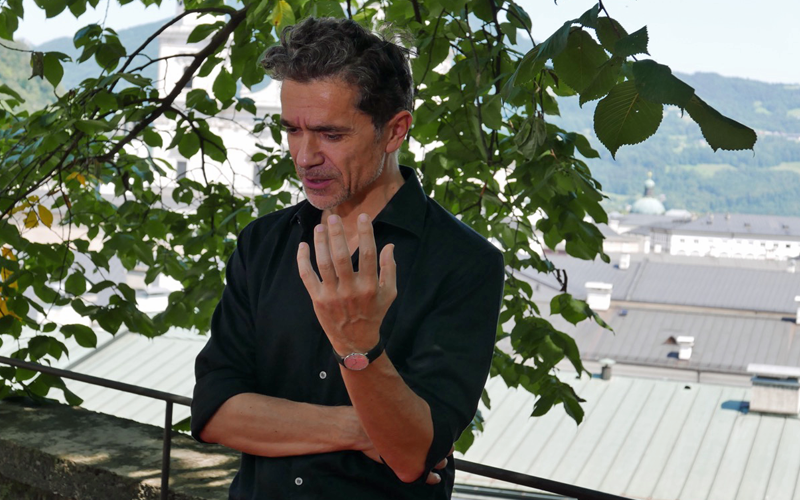Castellucci: „Leben in Kultur der Angst“
Er wolle bestimmte Momente in seinem Theater bewusst im „Dunkeln“ lassen und nicht „erhellen“, erzählt Castellucci zu den Triebfedern seiner Bühnenarbeit, die eine des geistigen Konzepts und eben nicht der Überwältigung durch Bilder sei. Castellucci sieht unsere Zeit in einem Überfluss der Bilder stranden. Der Überfluss der Bilder führe dazu, dass wir zu schauen und zu erkennen verlernt hätten. „Alles Sichtbare verhindert den Blick, verhindert die Erfahrung des Blicks“, meint er. Deshalb brauche man Orte wie das Museum und das Theater, um das elementare Gefühl für sich selbst wieder zu erlangen.
Der Regisseur aus dem italienischen Cesena ortet ein Klima der Angst und der Wunscherzeugung beim Einsatz den Bildmaschinerie der Gegenwart. Für die Künstler wünscht er sich „ein Konzil von Nicäa“, damit die Kultur des Sehens wieder auf neue Beine gestellt werden könne.
Opernhighlights im ORF
Der ORF zeigt die beiden Auftaktopern aus Salzburg.
- „Salome“, Samstag, 28. Juli, live-zeitversetzt um 21.55 Uhr in ORF2 sowie am Samstag, 11. August um 20.15 Uhr in 3sat.
- „Die Zauberflöte“, Samstag, 4. August, live-zeitversetzt um 20.15 Uhr in ORF2, live um 19.00 Uhr auf Ö1.
ORF.at: Sie haben bei der Präsentation ihrer Ideen zur „Salome“ über die Konfrontation mit dem Unbekannten gesprochen. Warum ist diese Konfrontation mit dem Unbekannten in Ihrer Arbeit wichtig?
Romeo Castellucci: Ich denke, einer der wichtigsten Gründe, warum Menschen ins Theater gehen, ist die Konfrontation mit dem Unbekannten in einer Welt mit bekannten Strukturen. „Salome“ ist ein perfektes Stück dafür. Denn das Rätsel des Verhaltens der Menschen ist ein zentraler Punkt in diesem Stück. Meine Arbeit besteht darin, die Ungewöhnlichkeit und Seltsamkeit dieser Personen zu schützen. Die Arbeit des Regisseurs liegt also nicht immer im Erklären oder Erleuchten der Dinge. Ich arbeite mit dem Schatten, versuche, ihn zu beschützen, und gestalte Umgebungen, in denen die Informationen bewusst fehlen. Das ist eine Form von Reichtum und Einbeziehung des Zusehers.
Konfrontation mit dem Unbekannten
„Die Aufgabe des Theaterregisseurs ist es, Dinge auch im Dunkel zu lassen und spezielle Räume zu schaffen, in denen es eigentlich einen Mangel an Informationen gibt.“
ORF.at: In „Salome“ gibt es drei starke Triebkräfte: Wunsch, Besessenheit und die Idee etwas sichtbar zu machen, Bilder zu erzeugen. Wie ist die Beziehung zwischen den Elementen?
Castellucci: Es gibt sicherlich das Element der Besessenheit, der Zwangshandlung, des Zwanges. Denn es gibt auch Verhaltensweisen, ich würde sagen, fast automatisierte. Es geht hier um eine Typologie von Verhaltensweisen. Ich würde sagen, dass hier jede einzelne Figur ein Verhalten darstellt, repräsentiert, das wir auch alle schon einmal in unserem Leben so erlebt haben.
ORF.at
Die Figuren in diesem Drama, in dieser Tragödie der Stimme, wie es definiert worden ist, präsentieren die Ganzheit einer Person. Die Zwangsbesessenheit enthüllt ein passives Verhalten, das der Passion, einer Leidenschaft. Die Figuren leiden an ihrem eigenen Wunsch. Der Wunsch ist ein Ansporn. Aber der Wunsch ist per Definition ein fehlendes Objekt. Deswegen ist es sehr wichtig, den (abgeschlagenen, Anm.) Kopf von Jochanaan richtig zu interpretieren: dass der Kopf von Jochanaan natürlich das Objekt der Begierde darstellt, das definitionsgemäß fehlt.
Wunsch und Begehren
„In der ‚Salome‘ leiden die Menschen und Figuren an ihren eigenen Wünschen, an ihrem Begehren.“
ORF.at: Könnte man sagen, dass Jochanaan das Konzept von Logos darstellt? Er singt ja zunächst aus dem Dunkeln, wir hören nur seine Stimme. Und die verkündet, dass etwas kommen wird, das wir noch nicht sehen.
Castellucci: Johannes ist eine außergewöhnlich starke und strafende Person. Er wird auch so in der Bibel definiert: eine Stimme, die in der Wüste schreit. Also ist Johannes vor allem eine Stimme. In der Ikonographie ist er dünn, sehr dünn. Er ernährt sich von Heuschrecken und Honig und kommt aus der Wüste mit seiner dunklen Sprache. Eine Ausdrucksweise, die nicht der Welt der Kommunikation angehört. Eine Sprache, die sich dem Spiel der Bezeichnungen entzieht. Das ist es, was Salome aufwühlt und was sie fasziniert.
Sie verliebt sich vor allem in die Sprache von diesem Logos. Sie nimmt ihn als Logos wahr und nicht wie ein Wort der Sprache, sondern sie spürt die Kraft. Die Aura, so mysteriös sie auch sei. Aber die Sprache ist mysteriös. Dann verliebt sie sich in die Stimme, und dann in den Körper. Und dann entkommt diese Ganzheit, denn sie fällt in das Gebiet der Begierde, des Wunsches, also grundsätzlich ins Nichts. Das macht sie zu einer Figur, die in uns lebt.
Wenn das Wort Fleisch wird
Jochanaan vertrete die Welt des Logos, so Castellucci, „er spricht eine Sprache, die sich dem Spiel der Bedeutungen entzieht.“
ORF.at: Wer hat eigentlich die Macht in diesem Spiel von sehen und gesehen werden? Der mit dem starken geistigen Konzept – oder jene Person, die begehrt?
Castellucci: Jochanaan ist der Stürmer, er ist Logos. Während Christus den Körper darstellt, die Fleischwerdung, sprichwörtlich. Aus diesem Betrachtungspunkt ist Jochanaan potent, mächtig. Die mächtige Erfahrung von Logos, der nicht nur verspricht, sondern schließlich erschafft. Die Schönheit dieser Gegenüberstellung, dieser Auseinandersetzung von Materie und Antimaterie. Salome repräsentiert in gewisser Weise die ‚pervertierte Inkarnation‘ – in der Logos durch das Fleisch geht, aber auf eine andere Art und Weise, eine gewaltsame Weise.
Sie benötigt dafür eine Waffe. Sie benötigt eine Waffe, um in den männlichen Körper einzudringen. In diesem Sinn ist es ein erotischer Körper, vielleicht nicht sexuell, aber erotisch. Das stellt sicherlich ein außergewöhnliches Missverständnis von Logos bei Jochanaan dar.
Bilder und Sehen
Dass er für den Gestalter eines vor allem von den Bildwucht geprägten Theaters gesehen wird, hält Castellucci für ein Missverständnis.
ORF.at: Was passiert im Moment, wo der Logos sichtbar wird? In Ihrer Arbeit ist ja immer wieder von der „Tyrannei des Blickes“ die Rede ...
Castellucci: Es ist sehr interessant zu sehen, wie das Sichtbare bestimmt wird von dem Widerstand des Nicht-Sichtbaren. Ein Bild ist ein Bild – wenn es ein Bild im Kampf mit dem Sichtbaren ist. Ein Bild ist ein Bild – und nicht nur in der Illustration, wenn es einen Kampf im Kopf gibt. Ein Bild ist also nur dann ein Bild, wenn es aus dem Kampf mit dem Nicht-Sein herauskommt.
ORF.at
Das sind philosophische Wortspiele, aber im Konkreten ist das tägliches Brot für denjenigen, der sich mit Theater oder Kunst auseinandersetzt. Der Konflikt ist also der Widerstand mit der flüchtenden Komponente, versteckt sozusagen bei bester Sicht. Man könnte sagen, dass die Kunst des Theaters die Kunst des Versteckens sei - wie man es schafft zu verstecken. Die entgegengesetzte Bewegung ist illustrativ.
ORF.at: Können wir, bis in unsere digitale Kultur, nur das sehen, woran wir vorher auch glauben?
Castellucci: Ich denke, dass der zeitgenössische Blick vom Lärm charakterisiert wird, vom weißen Rauschen. Also aus einem Mangel an Differenz. Der Überfluss der Bilder hat viel mit den Schmerzen dieser Epoche zu tun. Es ist ein weißes Geräusch, das anästhesiert, was den Blick paradoxerweise verhindert. Alles Sichtbare verhindert den Blick, verhindert die Erfahrung des Blicks.
ORF.at
Aus diesem Grund bleiben einige Orte und Bereiche privilegiert – und fördern das Bewusstsein über sich selbst. Das können Museen, Theater, vielleicht ein paar Wälder oder die Anwesenheit von Tieren sein. Aber es sind wenige Bereiche, ganz wenige, in welchen man sich bewusst wird, etwas zu sehen. Wir sehen uns sehen. Ich denke, das ist eine Geste der Neubewertung in einem existentiellen politischen Konsens in dieser Zeit.
ORF.at: In Ihrer Arbeit wird immer die Übermacht von Bildern über uns thematisiert, etwa in „Sul concetto di volto nel figlio di Dio“. Wie sollen wir heute mit den Bildern umgehen?
Castellucci: Ich denke, dass die Werbung eine neue Form des Faschismus darstellt. Die Menschen werden dominiert durch ihre Ängste und von ihren Wünschen. Also werden sie durch die Werbung kontrolliert. Es gibt eine Form von Totalitarismus, die sich hinter den Bildern der Werbung verbirgt. Man brauchte einen Konzil von Nicäa, das sich an die Künstler richtet. In dem man sich neu überlegt, umdenkt, denkt, was es eigentlich bedeutet zu sehen. Was es bedeuten kann und ob es sinnvoll ist, mit Bildern zu arbeiten.
Und es ist nicht als selbstverständlich anzusehen, dass Künstler die besseren Werber sind. Werber haben meistens schärfere Waffen als Künstler. Sie können viel tiefer in den Geist eindringen. Sie schaffen es, religiöser als Künstler zu sein. Ich finde, das ist eine sehr interessante Ära. Eine Ära großer Fragestellungen, Fragen, die so radikal wie die heutige Werbung sein sollten.
Das Interview führte Gerald Heidegger, ORF.at