Kampfeslust und Fabulierwut
Das lange Warten der Fans hat ein Ende: Die indische Schriftstellerin Arundhati Roy bringt 20 Jahre nach ihrem Welterfolg „Der Gott der kleinen Dinge“ einen neuen Roman auf den Markt. Am Donnerstag erschien „Das Ministerium des äußersten Glücks“ („The Ministry of Utmost Happiness“) auf Deutsch. Die mittlerweile 55-Jährige hat nach eigenen Angaben zehn Jahre daran gearbeitet.
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
Für ihr Erstlingswerk „Der Gott der kleinen Dinge“ („The God of Small Things“), der das indische Kastensystem kritisiert, hatte Roy 1997 unter anderem die bedeutendste britische Literaturauszeichnung, den Man Booker Prize, erhalten. In der Folgezeit schrieb sie hauptsächlich Essays und erregte mit ihrem politischen Engagement Aufsehen. So war sie unter anderem wegen Missachtung der Justiz einen Tag in Haft und musste eine Geldstrafe zahlen. Anlass war ihr Engagement für den Umweltschutz. Auch mit Kritik an der indischen Atomwaffen- und Kaschmir-Politik machte sie von sich reden.

AP/Stefan Rousseau
Arundhati Roy mit ihrem ersten Buch 1997
Roy wurde 2001 „für ihre Arbeit als Schriftstellerin und ihr Engagement im Kampf für die Menschenrechte in ihrem Land“ mit dem Jahrespreis der Pariser Weltakademie der Kulturen ausgezeichnet. Von ihrem 350 Seiten starken Buch „The God of Small Things“ wurden weltweit rund acht Millionen Exemplare verkauft.
Intensive Arbeitsweise
Zehn Jahre lang hatte Roy an ihrem neuen Roman geschrieben, was einerseits an ihrem mannigfaltigen politischen Engagement lag, andererseits eine bewusste Entscheidung war. Im Interview mit der „Vogue“ beschreibt sie ihre Arbeitsweise, einen intensiven Prozess, der immer wieder unterbrochen werden muss, in dem sich viel aus dem persönlichen Erleben und aus tagtäglichem Beobachten speist. Wo auch immer sie sich aufhält, wen sie trifft, was sie erlebt: Gibt es etwas her für eine Geschichte, werden Notizen gemacht, und die fließen dann in den Schreibprozess ein.
So ist es nur folgerichtig, dass es in ihrem neuen Roman, der mehreren Erzählsträngen an unterschiedlichen Schauplätzen folgt, vor allem um die politischen Verwerfungen in Indien geht, um die Korruption, um den Kaschmir-Konflikt, um den Backlash durch konservative Politik, um Befreiungsschläge aus den starren Angeboten für normierte Identitäten, die in der indischen Gesellschaft auch dort vorherrschen, wo das Kastensystem nicht mehr rigoros den Alltag prägt.
Im Haus der Träume
Mehrere Hauptfiguren führen durch den Roman. Eine etwa ist politische Aktivistin und trägt starke autobiografische Züge der Autorin. Ein weiterer ist Transvestit, der gemeinsam mit mehreren Transgender-Personen in einem - im Wortsinn traumhaften - „House of Dreams“ lebt. Roys Roman lebt nicht nur von der rezenten Geschichte Indiens und von den kulinarisch aufbereiteten Geschichten, sondern vor allem auch - wie schon „Der Gott der kleinen Dinge“ - von den intensiven, fast schon kitschigen Bildern. Roy fabuliert mit großer Lust.
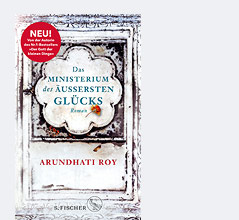
S. Fischer
Arundhati Roy: Das Ministerium des äußersten Glücks. S. Fischer, 560 Seiten, 24,70 Euro.
John Updike sagte einmal über Roy, sie habe eine völlig eigenständige Sprache entwickelt, ihr Talent sei mit dem des Golfers Tiger Woods vergleichbar. Und ihr enger Freund, der Schauspieler John Cusack, mit dem sie Reisen unternimmt und gemeinsam einen Band mit Essays veröffentlicht hat, sagte: „Arundhati schreibt entlang eines schmalen Grates, sie verfügt über unheimliche hellseherische Fähigkeiten. Sie ist eine allsehende, unheilbringende Voodoo-Priesterin.“
Licht und Schatten
Als unheilbringend, allerdings nicht im Cusack’schen, lobenden Sinne, wird sie auch von vielen Indern gesehen. Den Konservativen im Land gilt sie als Hassfigur Nummer eins. Gegenüber der „Vogue“ berichtete sie von zahlreichen Angriffen gegen ihre Person - nicht nur verbaler Natur. So, wie Roy gestrickt ist, spornt sie die Anfeindung durch ihre Gegner nur an. Das sei in ihrer DNA gespeichert, wie sie meint. Schon ihre Mutter war feministische Aktivisten, die sich von ihrem saufenden Ehemann trennte, als die kleine Arundhati zwei Jahre alt war - was im Indien der damaligen Zeit alles andere als selbstverständlich war.
Dieser Widerstandsgeist findet sich auch in Roys neuem Buch wieder, er wird von Rezensenten rund um den Globus einhellig gewürdigt. Die literarische Qualität von „Das Ministerium des äußersten Glücks“ ist jedoch umstritten. Während die einen meinen, das Buch schließe auch in dieser Hinsicht an den gefeierten Erstling an, meinen andere, der Roman sei ein ungelenkes Vehikel für politisches Engagement. Immerhin: Roy ist wieder für den Booker Prize nominiert, mit ihrem zweiten Buch zum zweiten Mal.
Links: