Geflügelte Wörter für gefiederte Nachbarn
Die fortschreitende Umweltzerstörung gefährdet die Existenz vieler Vogelarten. Zwei Bücher wollen die Natur über die Kultur wieder ins Bewusstsein ihrer Leserschaft zurückholen. Das eine mittels Akribie, das andere mit Humor.
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
Wie unsere Vorfahren, so stehen auch wir oft mit den Vögeln auf. Denn wir können nicht anders, wenn der Nachbarkohlmeiserich um fünf in der Früh der Welt seine Gebietsansprüche kundtut. „Didü“, schmettert dieser kugelrund-gelbwanstige Mini-Trump, der unumschränkte Herrscher des Luftraums über diesem Grätzel in der Steinwüste Wien: „Didü! Didü! Didü!“
Nach der zweiten Tasse Kaffee ist man in der Lage, über den Kohlmeiserich nachzudenken. Was macht er da eigentlich? Lockt er Meisendamen an? Vergrämt er Gegner? Will er seine Futtersäule nachgefüllt haben? Ich schlage das Vogelstimmenbuch auf, das mir der Kollege zur Rezension gegeben hat. Doch in dem Bändchen mit dem Titel „Singt der Vogel, ruft er oder schlägt er?“ geht es weniger um Inhalt als um die Form aviärer Kommunikation - und darum, wie Menschen deren Ausprägungen bezeichnen.
Zirpende Meisen
Der Germanist Peter Krauss hat nämlich recherchiert, wie verschiedene Laute der einzelnen Vogelarten in der deutschsprachigen Literatur bezeichnet wurden und hob damit einen gewaltigen Sprachschatz aus den Tiefen der Zeit. Doch wie jedes lange verborgene Ding kommen die Vokabeln dem Leser von heute etwas fremdartig vor.
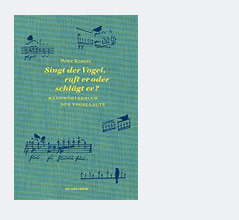
Matthes & Seitz Berlin Verlag
Peter Krauss: Singt der Vogel, ruft er oder schlägt er? Handwörterbuch der Vogellaute. Matthes & Seitz, 224 Seiten, 25 Euro.
Manche sind lautmalerisch sofort klar, andere wendet man hin und her und mag die Äußerungen der dazugehörigen Vögel trotzdem beim besten Willen nicht wiedererkennen. Der Kohlmeiserich, so lernen wir, kann „zirpen“, „zerpen“, „finken“, „binken“, gar „zinzelieren“. In Wirklichkeit sagt er aber meistens „Didü!“, eine Vokabel, die bei Krauss gar nicht vorkommt. Ein „Zizibä“, zitiert nach Cornel Schmitts „Wanderbüchlein für Vogelfreunde“, lässt Kohlmeiserich schon eher vernehmen.
Abstraktion statt Lautmalerei
Versuche, die Vogelstimmen möglichst exakt zu transkribieren, interessieren Krauss gerade nicht: „[Moderne Vogelkunden] nennen anstatt der alten Verben Lautmalereien, wie ‚bwo bwo‘, ‚grrhuk grrhuk‘ (Schallwörter), die in der Tat den vom Vogel produzierten Ton realistisch wiedergeben. [...] Die linguistische Problematik liegt heutzutage darin, dass die meisten erfahrenen Jäger, aber auch Naturfreunde die Rufe der Vögel kennen und erkennen, also den Vogel benennen können, dass sie jedoch die althergebrachten Bezeichnungen für diese Lautäußerungen ignorieren und sie so nach und nach in Vergessenheit geraten.“
Krauss geht es also eher darum, zumindest in interessierten Kreisen ein höheres Abstraktionsniveau bei der Beschreibung der Äußerungen von Vögeln zu erhalten und diese in einen historischen Kontext zu stellen. Finken „schlagen“ also nicht nur, sie „pinken“, „schirken“, „knarren“, „rücken“, „trillern“, „rulschen“, „quäken“ und „klickern“.
Vogelstimmen im Netz
Auf der Website Xeno-canto.org teilen Experten Lautäußerungen von Vögeln aus aller Welt. Die Schweizerische Vogelwarte Sempach stellt zu ihren Kurzprofilen der verschiedenen Arten auch Audiodateien bereit.
Vögel verschwinden zusehends aus der Lebenswelt der verstädterten Menschen, also schmilzt auch das Vokabular, mit dem wir sie beschreiben. Gegen die von Krauss angestrebte Abstraktion arbeitet aber auch das Netz, weil auf Vogelstimmenservern wie Xeno-canto.org die konkreten Laute vieler Arten unmittelbar verfügbar sind. Der Link auf die entsprechende Audiodatei ersetzt den zumeist archaischen Fachbegriff. Aber – und da hat Krauss recht – dem exakten Schreiben über die Kohlmeise ist das nur eingeschränkt zuträglich. Dann im Zweifelsfall doch lieber: „Didü!“
Satire als Strategie
Während Krauss das bestehende Vogelvokabular bewahren will, wird es von Jürgen und Thomas Roth in ihrem Werk „Kritik der Vögel“ signifikant erweitert. Da „gummiballt“ eine „kecke Kohlmeise“ bei Minusgraden im Novembergeäst herum, da „quäkt“ und „quokt“ und „queikt“ und „quörrt“ der Sperling. Das Buch verspricht „Klare Urteile über Kleiber, Adler, Spatz und Specht“ und liefert diese auch, ergänzt um Illustrationen vom Zeichentisch des Meisters F. W. Bernstein - ein Hinweis darauf, dass man, um das Buch genießen zu können, ein Freund satirischer Texte aus dem Umfeld der Neuen Frankfurter Schule („Titanic“) sein sollte.
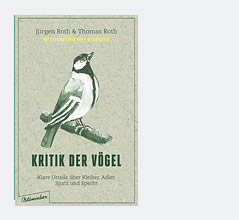
Blumenbar Verlag
Jürgen Roth, Thomas Roth: Kritik der Vögel. Illustriert von F. W. Bernstein. Blumenbar (Aufbau Verlag), 332 Seiten, 24,70 Euro.
Kritik ist im Internetzeitalter bekanntermaßen die führende Textgattung. Warum sollte man nicht auch Vögel kritisieren wie Zeitungsartikel, Politiker, Bücher (sic!), Smartphone-Modelle oder das Wetter? Was heute jedermann im Netz betreiben kann, war vor nicht allzu langer Zeit noch großen Geistern vorbehalten.
Diese, und das weisen die Roths mit einer Fülle von Zitaten aus den Federn berufener Experten wie Alfred Brehm oder Edmund Stoiber nach, waren in ihrer Urteilskraft die Vögel betreffend aber oft nicht wesentlich klüger als der durchschnittliche Forentroll. Wenn sich Menschen, auch die intelligentesten, über Vögel äußern, dann können sie nur irren, und die Roths überzeichnen diese Irrtümer mit Witz und großem Vergnügen.
Kritiker kletternder Kleiber
So weisen die Autoren anhand zahlreicher Quellen nach, dass Meisen (Kohl- und Blau-) „nicht ganz dicht“ und außerdem noch „kriminell“ sind. „Das arterhaltende Getöse der Meisen“ sei „in vielerlei Alltagssituationen nicht brauchbar und daher unerwünscht“. Aha. Der Kleiber sei eine „Nonspechtnichtmeise“, die für „unbefriedigende Konfusion“ sorge. Dabei sind Kleiber doch die einzigen Vögel in unserer Gegend, die einen Baumstamm nicht nur hinauf-, sondern auch hinunterklettern können. Die Konfusion im beobachtenden Menschen korrespondiert zweifellos mit der schnell wechselnden Weltsicht des Kleibers.
In ihrem Nachwort wechseln Jürgen und Thomas Roth die Tonlage, werden ernst. Menschen, speziell Vogelfreunde, würden dazu neigen, die Vögel zu stark zu idealisieren. Das wiederum würde den Blick auf die harte Realität verstellen. Und die sieht so aus: Vögel werden als Nutztiere gnadenlos ausgebeutet und ihr Lebensraum vernichtet. Fazit: „In toto gesehen scheint sich die Natur in die vom Menschen diktierten Verhältnisse zu schicken, genaugenommen: zu kapitulieren. Es ist ein stetiger Prozess, ein Auslöschungsprozess.“ Dieser Sichtweise gemäß brechen die Autoren in ihren Texten die üppig wuchernden Klischees über die besprochenen Vogelarten und räumen sie ab, um die Sicht zu klären. Sie wollen ihre Leser kritikfähig machen, ganz im Sinne der ursprünglichen Frankfurter Schule.
Dass die Kultur der Menschen der von ihnen gedankenlos ausradierten Natur ins Nichts folgt, ist das große gemeinsame Thema der beiden hier besprochenen und auch schwerstens empfohlenen Bände. Vögel gelten bei Biologen nicht umsonst als wichtige Indikatorspezies: Wo sie verschwinden, stimmt etwas nicht. Mag sein, dass ich deswegen dem kleinkriminellen Kohlmeisenwecker doch irgendwo dankbar bin, wenn er sich des Morgens meldet. Aber erst nach der zweiten Tasse Kaffee. Didü!
Links: