Die Leidenschaft der Sammler
Ein Gespräch mit dem Leiter der Fotosammlung des Wiener Filmmuseums, Roland Fischer-Briand, über Kinofans, käufliche Erinnerungen und die Notwendigkeit, analoge Filmfotografie genau jetzt zu sichern.
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
ORF.at: Unter einem Filmstill stellt man sich im Allgemeinen ein „angehaltenes“ Foto aus einem Film vor. In den beiden Ausstellungen, in der Albertina und im Photoinstitut Bonartes, an denen Sie kuratorisch beteiligt sind, gibt es allerdings genau das nicht zu sehen.
Roland Fischer-Briand: Dazu muss ich ausholen. Im Grunde gibt es drei Typen der Filmverwertungsfotografie. So lautet der offizielle Überbegriff für das, was man umgangssprachlich „Filmstill“ nennt. Da ist einmal das Szenenfoto, das am Set produziert wird. Es wirkt wie ein Bild aus dem Film, aber wenn man genau hinsieht, merkt man, dass die Kameraperspektive etwas anders ist und die Schauspieler vielleicht neu im Raum arrangiert wurden.
Wenn Teile der Ausrüstung oder der Regisseur im Bild sind, spricht man von einem Produktionsfoto. Heute würde man „Making-of“ sagen – solche Bilder gibt es ab den 30er, 40er Jahren. Sie sollen dokumentarisch wirken, sind aber genauso inszeniert wie die anderen. Und dann ist da klarerweise noch die Porträtfotografie – bei der die Fotografen größere künstlerische Freiheit hatten.

ORF.at/Maya McKechneay
Fischer-Briand vor dem Archiv des Filmmuseums in Wien-Heiligenstadt
ORF.at: Diese Porträtfotos wurden damals von Fans mit großer Leidenschaft gesammelt, oder?
Fischer-Briand: Es gab Postkartenverlage, die diese Fotos reproduziert haben. Die haben den Film als Einkommensquelle gesehen und ganze Sets produziert - und entsprechend dazu auch die Sammelalben. Für jeden Filmtitel zehn Motive. Bei den „Nibelungen“ von Fritz Lang waren es gleich 30 Motive.
ORF.at: Warum waren diese Bilder so beliebt?
Fischer-Briand: Im Kino geht man an die Kassa, zahlt und alles, was man für sein Geld bekommt, ist im Grunde eine Erinnerung. Es gibt zunächst mal nichts, was man anfassen und mitnehmen könnte, um diese Erinnerung zu aktivieren. Diese Lücke füllen dann das Kinoprogramm und die Filmpostkarte oder das Bild in der Filmzeitschrift.
ORF.at: Wie kommt man als Archiv an dieses private Sammelmaterial?
Fischer-Briand: Die Boxen und Mappen, die wir vorne gesehen haben, sind so eine Privatsammlung, die uns gerade geschenkt wurde. Ronald Butler, ein Brite, hat alles zu Hedy Lamarr (österreichische Schauspielerin, die in den 30er Jahren in Hollywood Karriere machte, Anm.) gesammelt. Wir konnten ihn überzeugen, dass wir die richtige Institution sind, diese Sammlung zusammenzuhalten.
Seine 200 Alben mit Presseausschnitten und Fotos behalten wir so in ihrer ursprünglichen Form, weil sie auch eine spezifische Form der Fanvergötterung spiegelt. Sogar Autogramme sind dabei und ein Schal, den Hedy Lamarr ihm mal geschenkt hat!
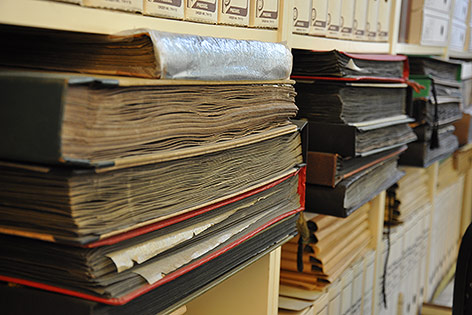
ORF.at/Maya McKechneay
Manchmal bekommt das Archiv eine Schenkung direkt vom Sammler
ORF.at: Neben solchem Fanmaterial gibt es aber auch noch die Kinoaushangfotos, die man auch heute noch aus den Kinofoyers kennt.
Fischer-Briand: Diese Bilder wurden und werden klassischerweise mit dem Trailer an die Kinos verschickt, um eine Vorlust auf den Film zu wecken. In unseren Sammlungsbildern sieht man oft noch die Nadeleinstiche, dort, wo sie in den Kinofoyers aufgehängt waren.
ORF.at: Gibt es auch Aushangbilder, die versuchen, spektakulärer zu sein als der Film selbst?
Fischer-Briand: Wenn man so will, ist das auch Thema der Ausstellung „Farbiges Leuchten“. In der Galerie Bonartes zeigen wir Setfotos aus Schwarz-Weiß-Filmen, die nachträglich von Hand koloriert wurden. Diese Bilder wurden dann von hinten beleuchtet und in den wichtigsten Premierenkinos aufgehängt. Damals gab es natürlich noch keinen Farbfilm, man hat allenfalls einzelne Szenen eines Films durch ein Farbbad gezogen und monochrom eingefärbt, also „viragiert“.
Diese Farben sollten im Film signalisieren, dass es Tag oder Nacht ist. Oder man wollte Stimmungen psychologisch aufladen: Grün war zum Beispiel eine Farbe, die das Unheimliche symbolisieren sollte. Die Kinoaushangfolien im Foyer waren etwas anderes: Hier war das Bild bis ins kleinste Detail vielfarbig nachkoloriert.

ORF.at/Maya McKechneay
Georges Melies, Dsiga Wertow, Fritz Lang und Co.: In diesen grauen Laden lagern große Namen
ORF.at: Seit wann gibt es eigentlich Filmstills?
Fischer-Briand: Unser ältestes Filmstill ist von 1911, aber weltweit gibt es auch ältere, von Melies schon aus den 1895er Jahren. Es gibt Epochen, in denen es einen größeren Schwung an Filmfotografie gibt, zum Beispiel Mitte der 20er Jahre. Damals wurde es technisch leichter, Fotos zu reproduzieren, in Magazinen zum Beispiel, durch den Rasterdruck. Damals wurden auch vermehrt Fotostudios innerhalb der Filmstudios gegründet.
ORF.at: Wozu Fotostudios? Hätte man nicht einfach vorhandene Filmkader aus dem gedrehten Material heraus vergrößern können?
Fischer-Briand: Nein, das ging technisch nicht. So ein Bild wäre damals noch unscharf und verwischt gewesen. In der Kinoprojektion fällt das nicht auf, auf einem herausvergrößerten Foto schon.
ORF.at: Wie haben die Studiofotografen dann gearbeitet?
Fischer-Briand: Mit Plattenkameras, die eine unglaubliche Schärfe und einen unglaublich hohen Qualitätsstandard in der Ausarbeitung haben.
ORF.at: Was weiß man noch von den Fotografen von damals, kennt man überhaupt ihre Namen?
Fischer-Briand: Dazu braucht es oft wirklich eine längere Recherche. Wir haben zum Beispiel einen größeren Bestand von Fotos von „Metropolis“, die sowohl in der Ausstellung der Albertina als auch in der Galerie Bonartes zu sehen sind. Bei diesen Aufnahmen weiß man, dass Horst von Harbou sie gemacht hat, der Leiter des Fotoateliers der UFA und Bruder der „Metropolis“-Drehbuchautorin Thea von Harbou, die wiederum die Ehefrau des Regisseurs Fritz Lang war. Aber oft gibt es gar keine Signatur.
ORF.at: Gab es auch weibliche Setfotografinnen?
Fischer-Briand: Ja, aber sie waren in der Minderzahl. Bekannt ist Madam D’Ora, Dora Kallmus, die in den 20er Jahren in Wien ein Atelier hatte und viele Filmschauspielerinnen porträtiert hat.
ORF.at: Seit wann gibt es eigentlich keine klassischen Filmstills mehr, wie man sie sammeln könnte? Und hat Ihre Sammlung mit der digitalen Ära eine Art Endpunkt erreicht?
Fischer-Briand: Es hat sich erst in den letzten fünf Jahren ergeben, dass die Filmbilder nur noch als FTPs oder Downloadlinks verschickt werden. Für mich als Leiter des Fotoarchivs bedeutet so ein Medienwechsel, dass es wieder etwas zu tun gibt: Das analoge Material der letzten zehn, 20 Jahre muss genau jetzt gesichert werden.
Das Gespräch führte Maya McKechneay, für ORF.at
Link: