Das Selbstreferenzielle als Dauerthema
Benjamin von Stuckrad-Barre hat sein Leben niedergeschrieben und huldigt damit gleichzeitig Udo Lindenberg. Schorsch Kamerun von den Goldenen Zitronen debütiert als Romanautor und erzählt die Geschichte von Horsti und seiner aktionistischen Punkband. Und mit Hans Platzgumer legt ein weiterer musiknaher Autor ein neues Werk vor, der damit große literarische Ambitionen und auch Humor zeigt.
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
Nach den Gesetzmäßigkeiten des Popbusiness musste es ja so kommen: Mit Anfang 20 wurde Stuckrad-Barre von seinem Debütroman „Soloalbum“ ins Rampenlicht der Literatur befördert. Der deutsche Pastorensohn schrieb sich mit der juvenilen Trennungsstory durch die Popkultur der 1990er Jahre, um dabei vor allem seinen damaligen Helden, die britische Band Oasis, Reverenz zu erweisen. Damit beschrieb er ein Lebensgefühl, das verstanden wurde, aber bisher keinen literarischen Niederschlag gefunden hatte.
Denn so viel popkulturelles Fandasein kannte die Leserschaft damals höchstens vom Briten Nick Hornby, der männlich ausgeprägtes Schallplattensammeln, die Anhäufung lexikalischen Popwissens und die ganz gewöhnlichen Nöte von Musikfans in „High Fidelity“ mit viel Witz und Geist thematisierte. Popliteratur fand auch im deutschsprachigen Raum ihr Publikum und vor allem Autoren.
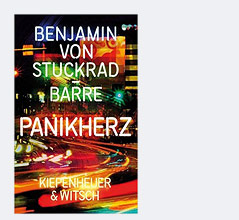
Kiepenheuer&Witsch
Benjamin von Stuckrad-Barre: Panikherz. Kiepenheuer & Witsch, 576 Seiten, 23,70 Euro.
Hoch und wieder runter
Stuckrad-Barre gab den diesbezüglichen Posterboy, der sich in der eigenen Rolle sehr gefiel – der Autor als umjubelter Popstar, der bei Rock am Ring vor 2.000 Menschen liest und eine eigene MTV-Show moderiert. Doch was raufkommt, kommt zwangsläufig auch wieder runter. Davon handelt „Panikherz“. Stuckrad-Barre zieht auf knapp 600 Seiten Bilanz über sein Leben und hat allen Grund dazu.
Die Eigendynamik des Erfolgs, die Suche nach Bestätigung und natürlich der Umstand, dass sich der Pastorensohn aus der deutschen Provinz in kürzester Zeit als Mediendarling wiederfindet und die Popwelt gar so schön artifiziell schillerte, führten, wie es auch das Popstarklischee verlangt, zur ausgeprägten Kokainsucht, durch die „Panikherz“ erzählerisch kurvt und mitunter auch schlittert, um dabei entsprechend viele Einblicke in das Wesen etlicher Entzugsanstalten zu geben.
Mit Udo in den USA
Doch „Panikherz“ ist nicht nur Drogenbiografie, Selbstsuche, Selbstrettung und Zwischenbilanz, sondern auch eine Huldigung an Udo Lindenberg, mit dem Stuckrad-Barre viele Monate in Kalifornien verbrachte, um daran letzten Endes zu genesen. Statt Songtitel von Oasis, wie einst bei Soloalbum, dient nun das Werk Lindenbergs als Fundus für die Kapitelüberschriften und allerlei anderweitiges Zitatbeiwerk. Die Erzählung über die Zeit mit Lindenberg in den USA, wo Stuckrad-Barre natürlich auf allerlei Prominenz wie Courtney Love, Rammstein und Thomas Gottschalk trifft, um dabei auch immer wieder vermeintliche Weisheiten fürs eigene Leben zu generieren, schiebt Stuckrad-Barre zwischen seine Rückblenden.
Udo, Udo, Udo
Doch bei aller Ehrerbietung für Lindenberg, den Stuckrad-Barre als Teenager verehrte, als cooler Musikjournalist hart anfasste, um sich mit steigendem Alter wieder an die Qualität der jugendlichen Emotion zu entsinnen und die Fanliebe neu zu entflammen – Stuckrad-Barre weiß auch zu übertreiben mit seinem Geflecht aus Assoziation zu Lindenberg, die bei ihm im Alltag immer und immer wieder geweckt werden. Udo ist Gott, was Udo sagt, hat Gewicht - damit muss der Leser leben. Auf der anderen Seite schön, dass Stuckrad-Barre seinen Lebensmenschen ganz offensichtlich gefunden hat - denn wie jede Suchtgeschichte verläuft auch Stuckrad-Barres Krankheitsverlauf nicht besonders schön. Und mit Udo Lindenberg möchte man als Leser nach all den Schilderungen dennoch gerne auf ein Bier gehen.
Grundmotiv Distinktionsgewinn
Dabei gibt sich Stuckrad-Barre in der Erzählung erstaunlich schonungslos sich selbst gegenüber und macht genauso seine Essstörung zum Thema, die den Konsum der südamerikanischen Drogenware nur beflügelte. Er zeichnet die letzten 20 Jahre als chaotischen Trip mit vielen Wohnortwechseln, Dealer-Bekanntschaften, drogengeschwängertem Wahnsinn, aber auch Karriereerfolgen und all den Unsicherheiten eines Kreativen in der Unterhaltungsbranche.
„Panikherz“ gibt sich generell ambivalent. Zwischen witzig, wehleidig, langatmig und dann wieder durchaus spannend in der Erzählung, liefert Stuckrad-Barre das große Spektrum ab. So mancher Promischwank ist einer zu viel, und dass das Motiv für die meisten Taten Stuckrad-Barres der eigene Distinktionsgewinn ist, schränkt die Empathiefähigkeit des Lesers gegenüber den offen zur Schau gestellten Leiden des Autors mitunter gehörig ein. Ein sehr ehrliches Buch ist „Panikherz“ dennoch.
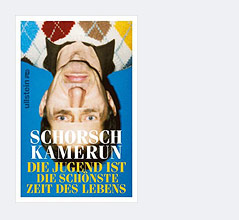
Ullstein Verlag
Schorsch Kamerun: Die Jugend ist die schönste Zeit des Lebens. Ullstein, 252 Seiten, 18,50 Euro.
Lesung: Donnerstag 24. Oktober im WUK in Wien um 19.00 Uhr.
Die Geschichte von Horsti
Literatur mit inhaltlicher und personeller Nähe zum Musikbetrieb erschien Anfang der Woche auch in Form von Schorsch Kameruns „Die Jugend ist die schönste Zeit des Lebens“ (Ullstein). Der Sänger der Hamburger Polit-Punk-Band Die Goldenen Zitronen veröffentlicht damit sein Romandebüt. Der längst auch als gefragter Theaterregisseur bekannt gewordene Kamerun, der immer schon mit den Mitteln der subtilen Provokation an der Störung des allzu Bürgerlichen arbeitete, erzählt dabei die Geschichte des junge Horsti, der in einem Kaff an der Ostsee namens Bimmelsdorf aufwächst und dort das frühe Rebellentum auslotet.
Schnell kommt die Musik ins Spiel, die er mit einem Kollektiv an Querköpfen betreibt, und er übt sich bald als Tommi from Germany in allerlei Aktionismus, um damit den gesellschaftlichen Konventionen zu trotzen - der subversive Rabauke, den es natürlich in die Stadt zieht, um im Lauf der Jahre als autodidaktischer Sturkopf, den die Ideologie treibt, auch am Theater Karriere zu machen.
„Ohne Eiche Rustikal“
Schorsch Kamerun hat mit „Die Jugend ist die schönste Zeit des Lebens“ ein offensichtlich autobiografisch angelehntes Werk verfasst, das von Selbstermächtigung ebenso erzählt wie von den damit einhergehenden Zweifeln - aber auch die Höhen und Tiefen eines Musikerlebens und das Messen von Erfolg zum Thema macht. Es geht um Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit und um das lustvolle Ausleben des eigenen Lebensentwurfs.
Kamerun schreibt und erzählt so, wie man es sich von ihm als Bühnenprovokateur erwartet. Mit Schnauze, schlagfertig, immer zum Angriff bereit und mit großer Überzeugung, wenn es darum geht zu erläutern, was im Leben wichtig ist. Der Punk dringt zwischen den Zeilen ständig durch, damit ja keine Missverständnisse aufkommen, was Sache ist, wenn aus Provokation Kunst entsteht.
Kamerun arbeitet im Roman mit Songtexten der Goldenen Zitronen aus allen Schaffensperioden und transformiert real existierende Orte - wie den von Kamerun lange Zeit betriebenen Golden Pudel Club in Hamburg in den fiktionalen Schauplatz Club mit dem besonderen Tier -, was insbesondere für einschlägige Musikfans ein nettes Rätseln bedeutet. Worum es im Leben nicht gehen soll, um ein glückliches zu leben, verrät Kamerun ohnehin sehr präzise in der Widmung des Buches: „Ohne Eiche Rustikal, Dauerbenotung und optimiertes Schaffen“.
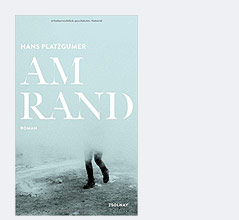
Paul Zsolnay Verlag
Hans Platzgumer: Am Rand. Zsolnay, 208 Seiten, 20,50 Euro.
Der Indierockstar als Autor
Ganz andere Töne schlägt Schorsch Kameruns ehemaliger Bandkollege bei den Goldenen Zitronen, Hans Platzgumer, an. Der gebürtige Tiroler und einstige Indierockstar, der Ende der 1980er Jahre mit seiner Band H. P. Zinker in den USA zur Genregröße wurde, veröffentlicht mit „Am Rand“ (Zsolnay) sein bereits sechstes Buch. Das Autobiografische hat Platzgumer bereits anno 2005 mit „Expedition“ aufgearbeitet. Mit der juvenilen Plaudersprache der Popliteratur hat Platzgumer allerdings nichts gemein. Mit großer Präzision erzählt Platzgumer die Geschichte des Gerold Ebner, der beschlossen hat, sein Leben in wenigen Stunden niederzuschreiben. Hoch oben in der eisigen Kälte des Gebirges auf einem Gipfel.
Der Tod als Dauerthema
Platzgumers Protagonist wächst in einer Südtiroler-Siedlung in Vorarlberg auf und durchlebt eine entsprechend raue Sozialisierung. Der Tod und die eigene Behauptung im Leben werden zum immer wiederkehrenden Thema für Gerold Ebner, der nicht nur einmal damit konfrontiert wird, selbst einen Menschen zu töten. Existenzielle Erfahrungen prägen Gerold Ebners bisheriges Leben.
Platzgumer gelingt dabei eine sehr eindrückliche Erzählung, die atmosphärisch finster und mitunter außerordentlich beklemmend gesponnen ist. Vor allem Platzgumers Schilderungen der von Gerold Ebner geleisteten Sterbehilfe machen den Tod zur tief eindringenden literarischen Naherfahrung. Platzgumer wählt dafür eine sprachliche Entschlossenheit, die umso mehr Sinn ergibt, je mehr sich die Geschichte weiterdreht.
Im Radio die B-Südtirolers
Und trotz der existenziellen Verhandlung des Lebens beweist Platzgumer großen Humor. Nicht nur wenn es um phonetische Verwechslungen aus dem Radio geht und die Bay City Rollers zu den B-Südtirolers werden.
Vollkommen ohne autobiografische Bezüge geht es auch bei Platzgumer nicht, der damit in erster Linie sehr viel Selbstironie beweist. Denn immer wieder taucht ein gewisser Platzgummer Hansi im Buch auf, der einst die Südtiroler-Siedlung, in der Gerold Ebner aufwuchs, als Jugendlicher in Richtung Amerika verlassen hat, um Rockstar zu werden – gehört haben sie nie wieder etwas von ihm. Nur Platzgummers KTM-Moped und die Erinnerung blieb: „Eine dürre, blasse Gestalt, die jeder von uns Skelett nannte, ein Eigenbrötler, der lieber im Keller Gitarre spielte, als mit uns auf der Wiese zu kicken.“
Johannes Luxner, ORF.at
Links: