Drahtseilakt im EU-Machtdreieck
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat erst vor wenigen Wochen im Fall des österreichischen Facebook-Aktivisten Max Schrems ein aufsehenerregendes Urteil gefällt. Auch das eben mit einer verwässerten Netzneutralität beschlossene Telekompaket wird, so glauben Kritiker, vor den 28 Richtern in Luxemburg landen. Immer wieder trieb der EuGH in den letzten Jahrzehnten die europäische Integration mit seinen Sprüchen quasi im Alleingang voran - großteils aus Überzeugung, doch teilweise wurde und wird dem Gericht diese Rolle aufgezwungen.
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
Grund ist eine systemische Schwäche im europäischen Entscheidungsfindungsprozess zwischen EU-Rat, -Parlament und -Kommission: Verordnungen und Richtlinien - die Gesetze der EU - sind häufig vage formuliert. Und das macht den Gerichtshof zum Lückenbüßer - eine mächtige, aber heikle Rolle. Wo die europäische Politik „handlungsunfähig oder ein Thema sehr kontrovers“ sei, entstünden „Regelungslücken“, erklärt die Politologin Susanne Schmidt gegenüber ORF.at. In solchen Fällen werde häufig der EuGH angerufen.
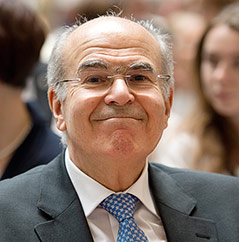
APA/EPA/Daniel Naupold
Zwölf Jahre lang stand Skouris dem EuGH als Präsident vor
„Nicht gewählt“
Doch damit kommt dem Gerichtshof „unausweichlich eine politische Rolle zu“, so Alberto Alemanno, der Europarecht an der Pariser Ecole des hautes etudes commerciales (HEC) und der New York University unterrichtet. „Aus einem einfachen Grund sagen wir das aber ungern: weil die Richter nämlich nicht gewählt sind.“ Sie könnten nicht „zu politisch“ sein, denn dazu fehle ihnen die demokratische Legitimation, und es würde zugleich ihre Unabhängigkeit gefährden. Der EuGH müsse daher ständig „einen Hochseilakt vollführen“, so Alemanno im Gespräch mit ORF.at.
Dass sich die Luxemburger Richter in dieser Rolle nicht besonders wohlfühlen, sprach der jüngst abgetretene Präsident des EuGH, Vassilios Skouris, vor drei Jahren in einem Interview mit der Zeitung „Die Welt“ ganz offen aus: „Wenn eine Richtlinie klar und deutlich formuliert ist, sind wir Richter weniger mächtig. Dann sind wir sogar glücklich.“
Klarheit im „Graubereich“
Neue Gesetze in strittigen Punkten bewusst vage zu formulieren - genau das, was sich EU-Rat und -Parlament immer wieder erlauben, um überhaupt zu einem Kompromiss zu kommen - dürfen die Richter nicht: Diese könnten nicht mehrdeutige Urteile fällen, so Alemanno. Sie seien vielmehr zu Klarheit verpflichtet, auch wenn es selbst bei EuGH-Urteilen eine gewisse „Kompromissdimension“ gebe. EuGH-Verfahren werden nie von einem einzelnen Richter, sondern von einer Richterkammer entschieden, die - je nach Komplexität des Falls - aus drei, fünf oder 15 Richtern besteht.

APA/AP/Geert Vanden Wijngaert
Die große Spruchkammer des EuGH
Der EuGH halte aber jedes Mal, wenn er eine Entscheidung in einem „Graubereich“ treffe, das in seiner Urteilsverkündung fest. Und: Bei wirklich großen Punkten verweigere sich der EuGH überhaupt, in die Lückenbüßerrolle zu schlüpfen, so Alemanno.
Höchstrichter und der Zeitgeist
Schmidt und Alemanno glauben aber nicht, dass es eine gezielte Strategie der 28 Staaten im Rat und des Parlaments als Kogesetzgeber gibt, die Frage, wie sehr und auf welche Weise genau sich ein EU-Gesetz für die 500 Millionen EU-Bürger letztlich auswirkt, dem EuGH zu überlassen. Das ergebe sich vielmehr zwangsläufig aufgrund der oft völlig gegensätzlichen Interessenlagen, die es gelte, unter einen Hut zu bringen. Gebe es dann noch Zeitdruck wie bei der Euro-Krise oder wolle ein EU-Vorsitzland das Thema unbedingt während seiner turnusmäßigen Präsidentschaft abschließen, käme es zu unpräzisen, mehrdeutigen Beschlüssen.
Über die Zeit habe der EuGH generell betrachtet klar eine Position „pro Integration“ vertreten, darin sind sich Schmidt und Alemanno einig. Aber so wie für jedes andere Gericht gelte auch für den EuGH, dass er nicht völlig losgelöst von den aktuellen gesellschaftlichen und politischen Gegebenheiten agieren kann. Sonst müsse das Gericht seine Entmachtung fürchten, so Schmidt, denn: „Urteile müssen auch befolgt werden, sonst ist der EuGH die längste Zeit ein starkes Gericht gewesen.“ „Es wäre nicht klug, wenn der EuGH die Erwartungen der Gesellschaft gar nicht berücksichtigt“, stößt Alemanno ins gleiche Horn.
In dem Zusammenhang betonen beide, dass Urteile aus der jüngeren Vergangenheit einem politischen Stimmungswandel Rechnung tragen: „Weil es nicht mehr dem ‚Zeitgeist‘ entspricht, auf mehr Integration zu drängen“, habe auch der EuGH hier nun einen „zurückhaltenderen Zugang“, so Alemanno.
„Formelkompromiss“
Rat, Kommission und Parlament beherrschen die Kunst, Gesetze so zu formulieren, dass man sie unterschiedlich interpretieren kann. „Formelkompromiss“ nennt das Susanne Schmidt.
EuGH und „Brexit“
Konkret lasse sich beim EuGH in der Frage vom Zugang von Bürgern aus anderen EU-Ländern zu nationalen Sozialleistungen - in Großbritannien eine besonders umstrittene Frage - eine „deutlich restriktivere Haltung beobachten“, so die an der Universität Bremen lehrende Schmidt. Während frühere Urteile die Rechte ausgeweitet hatten, gab es zuletzt Sprüche, die einschränkend wirken.
Im November 2014 etwa im Fall Dano vs. Jobcenter Leipzig, als der EuGH entschied, dass Unionsbürger, die sich allein mit dem Ziel, in einem anderen EU-Land Sozialhilfe zu bekommen, dorthin begeben, von bestimmten Sozialleistungen ausgeschlossen werden können. Im September dieses Jahres folgte ein weiteres Urteil: Im Fall Alminovic vs. Jobcenter Berlin Neukölln entschied der EuGH, dass ein eingereister Unionsbürger, der auf Arbeitssuche ist, unter bestimmten Umständen von Sozialleistungen, konkret der Unterstützung für Langzeitarbeitslose, ausgeschlossen werden kann.
„Kommentatoren haben dann gesagt: ‚Ah, der EuGH liest auch Zeitung‘“, so Schmidt in Bezug auf das EU-Referendum im Vereinigten Königreich („Brexit“). Restriktivere Zugangsregeln zu britischen Sozialleistungen für Angehörige anderer EU-Länder sind eine der Hauptforderungen des britischen Premiers David Cameron gegenüber Brüssel.
Noch 2012 hatte der EuGH im Fall eines deutschen Pensionisten, der in Österreich lebte und die Ausgleichszulage beantragte, entschieden, dass das kein automatisch hinreichender Grund sei, diesem das Aufenthaltsrecht zu entziehen. Der EuGH hatte darin also den Zugang zu Sozialleistungen für Unionsbürger noch nicht restriktiv interpretiert.
„Ein Maßstab fällt weg“
Cameron will in den aktuell laufenden Verhandlungen mit der EU Medienberichten zufolge auch erreichen, dass ein Satz aus der Präambel des EU-Vertrags gestrichen wird. Konkret geht es um die Bestimmung, Ziel der EU sei eine „immer engere Gemeinschaft“. Sollte dieser Passus tatsächlich gestrichen werden, hätte das laut Alemanno Folgen für den EuGH und die EU insgesamt. Denn die Luxemburger Richter verwendeten die Formulierung immer wieder „als Hinweis, wie er viele andere Verfügungen interpretieren soll“. Werde der Satz gestrichen, falle für das Höchstgericht „ein Maßstab“ weg. „Rechtlich gesprochen könnte das einen Unterschied machen - und die prointegrationistische Interpretation der EU-Verträge durch den EuGH schwächen“, so Alemanno.
Guido Tiefenthaler, ORF.at, aus Brüssel
Links: