Eine Straße als Kind ihrer Zeit
Länger als die meisten anderen europäischen Großstädte hat Wien seinen Stadtkern mit Mauern und Befestigungsanlagen umgeben gehalten. In der Mitte des 19. Jahrhunderts machte sich die Habsburgermonarchie aber schließlich daran, ihrer Reichshauptstadt ein neues Gesicht zu verpassen - und schenkte Wien mit der Ringstraße ein Kind einer zerrissenen Zeit.
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
Beliebt war er am Anfang seiner Regierungszeit nicht unbedingt – auf die Symbolik verstand sich Franz Joseph aber bereits als junger Kaiser: Am Weihnachtstag des Jahres 1857 veröffentlichte die Wiener Zeitung auf der Titelseite ein Handschreiben des Monarchen: Kaum mehr als 800 Wörter reichten Franz Joseph darin für die Umschreibung eines Großprojekts, das Wiens Antlitz radikal ändern sollte. Anstelle der Stadtmauern und der freien Fläche davor - das Glacis - sollte eine Prachtstraße mit Prunk- und Wohnbauten entstehen.
Bereits fünf Tage zuvor war das Schreiben auf dem Tisch von Innenminister Alexander Freiherr von Bach gelegen. Der Jurist und Politiker hatte sich seit Jahren für eine Ringstraße anstatt der alten Befestigungsanlagen eingesetzt. Am Ende war er dennoch Befehlsempfänger. „Es ist mein Wille“, setzt das Auftragsschreiben des Kaisers an und lässt keinen Zweifel aufkommen, wer hier den größten Umbau in der Stadtgeschichte anstößt. Bereits acht Jahre später konnte der Kaiser „seine“ Ringstraße eröffnen. Auch wenn an der Prunkstraße noch jahrzehntelang gebaut werden sollte.
„Straße zwischen den Zeiten“
Das Großprojekt war als Symbol einer starken und mächtigen Monarchie erdacht. Es sollte Wien zu einer Reichshauptstadt machen, die den Vergleich mit Paris oder London nicht zu scheuen brauchte. Dass es mit seinem Großreich kaum 50 Jahre später vorbei sein würde, konnte Franz Joseph damals nicht wissen. Als „Straße zwischen den Zeiten“ bezeichnet Alfred Fogarassy, Herausgeber des jüngst erschienen Bildbands „Die Wiener Ringstraße“, den Boulevard rund um die Wiener Innenstadt. Und liefert damit eine zwar ins Pathetische gehende, aber nichtsdestoweniger passende Beschreibung.

Wien Museum
Über Jahrzehnte säumten Großbaustellen - hier das Parlament - die Ringstraße
Historiker sprechen gerne vom „langen 19. Jahrhundert“ - und meinen damit die Zeit von der Französischen Revolution bis zum Beginn des Ersten Weltkriegs. Eine große Klammer für eine zerrissene Epoche - in Europa und ganz besonders in Österreich: Die Monarchie kämpfte ein Rückzugsgefecht gegen das andrängende Volk, gegen Nationalismen und Unabhängigkeitsbestrebungen. Auf der anderen Seite stand das Militär, das zunehmend Einfluss und Macht einforderte. Und neben all diesen Ansprüchen lebte noch immer der Traum eines (neo-)absolutistischen, alle Widersprüche ausgleichenden Monarchen.
Ruhm und Glanz im Zitat
In diese innere Zerrissenheit hinein begann die Planung des Großprojekts Ringstraße. Und am Ende wurde es neben groß und prunkvoll eben auch zum Symbol dieser Zwiespältigkeit. Die neuen Bauten wollten in die Zukunft weisen und waren doch in der Vergangenheit festgezurrt. Die Architektur des 19. Jahrhunderts beherrschte vor allem eines perfekt: den Rückgriff auf die Vergangenheit - das aber in Perfektion.

picturedesk.com/J.Riegel
Das Wiener Rathaus hat seine Vorbilder ganz bewusst in Flandern
So stand hinter den historischen Stilzitaten durchaus System: Die flämische Neogotik des Rathauses verwies auf das Erstarken des Bürgertums im Mittelalter. Das Universitätsgebäude verbeugte sich mit seiner Formsprache der Hochrenaissance vor der Wiederentdeckung der Wissenschaften. Für das Parlament griff Theophil Hansen auf die griechische Antike zurück - die Wiege der Demokratie. Und es verwundert kaum, dass die Neue Hofburg samt Kaiserforum stilistische Anleihen an der römisch-antiken Architektur nahm.
Gut versteckter Stahl
Hinter den historisierenden Fassaden stand aber ebenso eine Bautechnik auf der Höhe ihrer Zeit: Stahl und Eisen hatten gerade eben den Weg in die Architektur gefunden. Die Hofkanzlei hatte Eisen sogar erst 1845 für den Hochbau zugelassen. Da erscheint der breite Einsatz des neuen Baustoffs beinahe revolutionär: Viele der großen Kuppeln und Dachkonstruktionen über den Monumentalbauten waren Stahlgerüste - in fast allen Fällen von der IG Gridl konstruiert. Oftmals übernahm das junge Wiener Unternehmen Planung, Fertigung und Aufbau der Stahlträger.
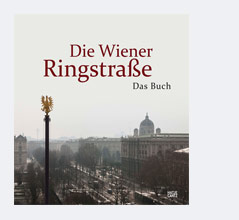
Hatje Cantz Verlag
Buchhinweis
Alfred Fogarassy: Die Wiener Ringstraße. Hantje Cantz, 264 Seiten, 58 Euro.
Danach mussten Ignaz Gridl und seine Mitarbeiter aber zusehen, wie die eigenen Konstruktionen schnell hinter Stuck und historischem Dekor verschwanden. Eisen und Stahl gingen mit den historistischen Stilvorgaben nicht zusammen. Das galt für die Fassaden ebenso wie für die Innenräume.
Aus Brandschutzgründen wurden die Zuschauerräume von Oper und Burgtheater als Eisenskelettbauten konzipiert. Zu Gesicht bekamen die Theaterbesucher davon freilich nichts. Die Pfeiler und Träger waren in den Gangmauern verborgen oder lagen in den Trennwänden der Logen. Gleiches gilt für den großen Kuppelsaal im ersten Stock der Neuen Hofburg. Dort geben Scheinsäulen vor, die Kuppel zu tragen, die doch eigentlich auf einem hinter den Wänden versteckten Stahlgerüst ruht.
Vom Aufbrechen der Zerrissenheit
Erst kurz vor dem Ende der Monarchie wagte ein Ringstraßenarchitekt den offensiven Schritt auf das neue Material zu. Otto Wagner zeigte geradezu spielerisch, wie die Zerrissenheit der Zeit überwunden werden konnte. Sowohl im Innenraum als auch an der Fassade ließ er bei seinem Postsparkassengebäude den Stahl offen zutage treten, machte ihn sogar zu einem stilistischen Element. Und läutete mit seinen Entwürfen den Beginn der Moderne in Wiens Architektur ein.

ORF.at/Doris Rauh
Otto Wagner verabschiedete sich als einer der Ersten vom Historismus
Ausstellungshinweis
Das Ringstraßenjubiläum ist heuer Thema zahlreicher Ausstellungen. Besonders umfangreich widmet sich das Wien Museum mit „Der Ring – Pionierjahre einer Prachtstraße“ dem Boulevard und seiner Geschichte. Die Ausstellung ist ab 11. Juni zu sehen.
Sein Projekt verwirklichte Wagner genau dort, wo bis 1900 die Franz-Joseph-Kaserne gestanden war - ein burgartiger Bau, der als direkte Reaktion auf das Revolutionsjahr 1848 gebaut worden war. Gemeinsam mit der bis heute bestehenden Rossauer Kaserne war das Militärgebäude Zeichen dafür, dass der Ring nicht nur verbindendes Element war - sondern ebenso schnell zur Trennlinie werden konnte. Über die breite Straße sollte das Militär schnell in die Innenstadt kommen und mögliche Revolutionen im Keim ersticken. Auch hier war Wiens Prachtboulevard einmal mehr in den Spannungen seiner Zeit verhaftet.
Zusammengewachsene Stadt
Als 1906 Wagners Postsparkasse eröffnet wurde, hatte das Militär freilich „seine zentrale Position in allen Fragen der Stadterweiterung längst eingebüßt“, schreibt der Kunsthistoriker Andreas Nierhaus. Auch der Neoabsolutismus Franz Josephs war einer konstitutionellen Monarchie gewichen. Und die Verbindung zwischen Vor- und Innenstadt übernahm mittlerweile die Eisenbahn.
1898 hatte mit der Vorortelinie die Wiener Stadtbahn ihren Betrieb aufgenommen. Ein Jahr später fuhr die Wientallinie bereits von Meidling bis zum Zollamt am Donaukanal. Die Vorstädte schienen dem Stadtzentrum so nah wie nie zuvor, die Metropole Wien war zusammengerückt. Maßgeblich daran beteiligt: Otto Wagner. Die Stadtbahnstationen sind allesamt seine Entwürfe.
Martin Steinmüller, ORF.at
Links: