„Hoher Nachholbedarf auch im Westen“
25 Jahre nach dem Mauerfall erscheint das Gebiet der ehemaligen DDR weitgehend saniert, und geht es nach der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, haben sich „die meisten Hoffnungen erfüllt“. Doch nicht nur für Merkel steht außer Frage, dass es „natürlich noch viel zu tun“ gebe - unter maroder Infrastruktur leidet mittlerweile nicht zuletzt Deutschlands Westen.
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
Bereits seit Jahren schlagen Experten allein mit Blick auf Deutschlands Verkehrsnetz Alarm, und auch in diesen Tagen wird erneut der Vorwurf laut, dass zu wenig Geld in die Instandhaltung der Straßen und Brücken investiert wird. „Deutschland, die Schlaglochrepublik“ titelte etwa die Deutsche Welle, der zufolge die fehlenden Investitionen „Stück für Stück zu immer schlechteren Verkehrswegen“ führen.
„Wir riskieren hier nicht unsere Busse“
Betroffen sind nicht zuletzt die Kommunen, in deren Zuständigkeitsbereich mit weit über 600.000 Kilometern der Löwenanteil von Deutschlands 920.000 Kilometer umfassendes Straßennetz fällt. Mehr als die derzeit praktizierte „teure Flickschusterei“ sei mit Blick auf die leeren Gemeindekassen allerdings nicht machbar, so der Deutsche Städte und Gemeindebund (DStGB), es fehlten „schon heute Milliardenbeträge, um wenigstens die notwendigsten Straßensanierungen durchzuführen“.
Als drastisches Beispiel nennt „Die Welt“ die Berliner Hildegard-Jadamowitz-Straße und die Weigerung der Berliner Verkehrsbetriebe, ihre Busse noch weiter über die zahllosen Schlaglöcher zu schicken. Doch kaputte Infrastruktur wie diese gibt es der Zeitung zufolge „überall in Deutschland“ - und das Problem ist alles andere als neu. Vielmehr sei dieses „seit mindestens zehn Jahren ganz offensichtlich“, so Klaus-Peter Müller, Präsident des Deutschen Verkehrsforums (DVF). Ein dichtes und gutes Verkehrsnetz sei zwar noch immer „eine Stärke unseres Landes, aber wir sind dabei, das zu verspielen“, so Müller laut „Welt“ weiter.
Warnung vor Verkehrskollaps
Die „Süddeutsche Zeitung“ („SZ“) warnte auch vor einem drohenden Verkehrskollaps. Diskussionen über neue urbane Verkehrskonzepte - Stichwort Elektromobilität - seien zwar gut gemeint, Bürgermeister und Verkehrspolitiker in Deutschlands Rathäusern hätten derzeit allerdings ganz andere Sorgen. Angesichts fehlender Gelder für die Anschaffung neuer Busse und die Erhaltung bzw. den Ausbau des Verkehrsnetzes stelle sich der Zeitung zufolge vielmehr die Frage, wie man die Städte davor bewahren kann, „in einer Lawine aus Blech unterzugehen“.
Allein in München seien in den kommenden zehn Jahren 2,5 Milliarden Euro für die Erhaltung bestehender Anlagen, darunter etwa die über 40 Jahre alten U-Bahn-Röhren, notwendig. Doch nicht nur in München, auch in vielen anderen westdeutschen Städten waren kommunale Unternehmen jahrelang gezwungen, auf Kosten der Substanz den Betrieb aufrechtzuerhalten, „weswegen nun dringend Ersatzinvestitionen nötig wären“.
Doch allein für den Erhalt der zum großen Teil aus den 60er und 70er Jahren stammenden Straßen fehlen Deutschland jährlich 7,2 Milliarden Euro, so die Deutsche Welle mit Verweis auf eine Kommission von Bund und Ländern. Ähnlich verhält es sich im Schienennetz, wo ebenfalls ein milliardenschwerer Reparaturbedarf seit Jahren vor sich hin geschoben wird. Als besonders „besorgniserregend“ gilt aber der Zustand in den Kommunen, wo laut Deutschem Städtetag bereits weit über 100 Milliarden für Straßen, Schulen und sonstige Infrastrukturmaßnahmen fehlen.
„Nicht mehr nach Himmelsrichtung“
Zu schaffen macht den Kommunalkörperschaften aus DStGB-Sicht nicht zuletzt die staatlich verordnete Schuldenbremse. Einerseits müssten Kommunen Schuldenabbau betreiben, andererseits für die Zukunft investieren, wofür ihnen vielfach jedoch die Mittel fehlen, so DStGB-Volkswirt Jörg Zeuner. Neu überdacht werden muss Zeuner zufolge aber auch der ohnehin umstrittene „Solidarpakt“ und damit jene Pflichtabgabe, die Anfang der 90er Jahre zur Finanzierung von „Aufbau Ost“ ins Leben gerufen wurde.
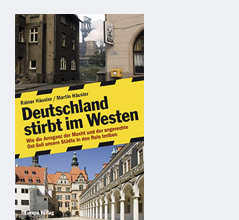
Europa Verlag
Buchhinweis
Rainer und Martin Häusler: Deutschland stirbt im Westen. Europa Verlag, 176 Seiten, 18,50 Euro.
Das System des Solidaritätszuschlags habe sich Zeuner zufolge zwar entgegen der häufigen Kritik bewährt und für den Aufholprozess der Städte und Gemeinden im Osten einen wichtigen Beitrag geleistet - „ein enormer Investitions- und Nachholbedarf“ bestehe nun aber auch in vielen westlichen Regionen, und dieser Entwicklung müsse nun auch Rechnung getragen werden. Künftig solle „nicht mehr nach Himmelsrichtung“ gefördert, sondern „gesamtdeutsch“ gedacht werden, so der DStGB-Experte, der damit wie viele andere die „Soli“-Gelder künftig auch in Westdeutschland eingesetzt sehen will.
„Aufbau Ost“ dank westdeutscher Schulden?
Bis dahin muss der Westen aber weiterhin Geld Richtung Osten überweisen, „sehr zum Ärger westdeutscher Gemeinden, die das Geld selbst dringender denn je benötigen“, so die „Aachener Zeitung“ mit Blick auf die seit Jahren steigende Zahl an Kommunen, die sich gegen den Solidaritätszuschlag in seiner jetzigen Form wehren.
Von einem „Unding“ sprechen dabei die Autoren des Buchs „Deutschland stirbt im Westen“, Rainer und Martin Häusler, die gleichzeitig die gewagte These liefern, dass der „Aufbau Ost“ ohnehin nur mit Schulden der Weststädte gelingen konnte. Fast alle der rund 400 Städte und Gemeinden sind zum Teil sehr hoch verschuldet, wie am Beispiel des deutschen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen veranschaulicht wird. „Das Herz der Republik ist schwer krank“, so der Befund des Buches, in dem gleichzeitig eine Abschaffung des „Ost-Soli“ gefordert wird.
Ungeachtet dessen stehen die Zeichen auf Fortführung der an sich 2019 auslaufenden Sonderabgabe, wenn auch unter gänzlich neuen Vorzeichen. Die deutschen Bundesländer sind sich bei laufenden Verhandlungen mit der Bundesregierung jedenfalls einig, dass der Solidaritätszuschlag in Höhe von derzeit 15 Milliarden Euro erhalten bleiben soll, und Finanzminister Wolfgang Schäuble will auch nicht mehr gänzlich ausschließen, den „Soli“ künftig mit den Bundesländern in ganz Deutschland zu teilen. Eine schnelle Einigung dürfte es Beobachtern zufolge dennoch nicht geben und geht es nach Schäuble, wird es für die Kommunen ohnehin nicht reichen, „nur auf Mittel des Bundes zu schielen“.
Links: