Stärken und Schwächen des Kaisertums
Karl der Große und das Karolinger-Reich dienen bis in die Gegenwart als Projektionsfläche. Im Interview mit ORF.at erläutert der renommierte Mittelalterexperte Karl Brunner die Stärken, aber auch die Grundproblematik der Kaiserreichsidee Karls. Das Vermächtnis Karls sieht Brunner besonders im kulturellen und kirchlich-liturgischen Bereich. Und der Historiker erinnert an vergessene Erbschaften Karls, etwa die Schaffung des Bauerntums durch die große Agrarreform.
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
ORF.at: Karl der Große ist heute eine Projektionsfigur, an der viele Identitätsfragen Europas aufgehängt werden. Wo sehen Sie Elemente seiner Herrschaft, die er uns fast unbemerkt hinterlassen hat?
Brunner: In der Renaissance hat man versucht, eine antike Schrift wiederzubeleben. Und Karl den Großen zählte man damals zur Antike. Es ist die karolingische Groß- und Kleinschreibung, die man zur Zeit der Renaissance zur Standardschrift erklärte, und letztlich haben wir sie heute noch mit der Groß- und Kleinschreibung. Diese karolingische Minuskel entsteht über zwei bis drei Generationen in den fränkischen Klöstern, sie gilt aber dann, weil unter Karl dem Großen fertig und eingeführt, als die Schrift Karls des Großen.
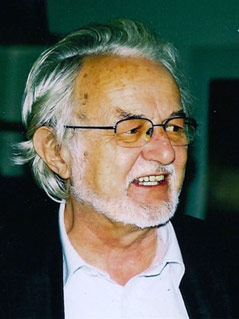
Maleczek
Mittelalterexperte Karl Brunner
ORF.at: Wie nähert man sich eigentlich einer Figur wie Karl dem Großen vor dem Hintergrund, dass er auf der einen Seite so viel an Projektionsfläche und Fiktionen für spätere Zeiten bot und die Quellenlage andererseits ja durchaus lückenhaft ist?
Brunner: Das Geschäft das Historikers besteht darin, die „Kronen Zeitung“ zu lesen und doch informiert zu sein. Als Historiker ist man gewohnt zu fragen: Wer sind die wirklichen Akteure, wer sind die Pressure-Groups? Wer hat in der Durchführung das Sagen?
ORF.at: Das heißt, fragt man nach Karl dem Großen, fragt man nicht zuletzt danach, wie er die Herrschaftsstrukturen seiner Vorgänger zum effizienten Herrschaftssystem ausbaute?
Brunner: Ja. Vor allem: Was kommt von oben nach unten an und was nicht. Etwa im kirchlichen Bereich. Also mit der zentralen Besetzung der Bistümer. Es gelingt, eine Sprache und eine Liturgie im ganzen Reich durchzusetzen. Die Struktur des Jahreskreises ist im Reichsevangeliar aufgesetzt. Oder das Singen, das durchgesetzt wird. Die Geistlichkeit in Rom in dieser Zeit ist ja entsetzt über den fürchterlichen Gesang der Franken.
ORF.at: Ist die Kirche in diesem System das, was heute die Medien sind oder so etwas wie die Öffentlichkeitsarbeit in einem Reich?
Brunner: Ja. Vor allem kommt sie in die Rolle ähnlich der Printmedien. Weil die Klöster mit ihren Handschriften vieles überzeitlich festhalten. Vieles andere ist ja einem starken Wechsel unterworfen. Es gibt eine Kultur der Schriftlichkeit, die auch in den Hof hineinreicht, aber auch die ist von Kirchenleuten dominiert. Wenn Karl einen seiner Vertrauten, Arn, nach Salzburg schickt und zum Erzbischof macht, ist für ihn gesichert, dass seine Ideen in weltlicher und geistlicher Hinsicht durchgesetzt werden - und dass seine Ansichten zu allen heiligen Zeiten gepredigt werden. Und mit dem wieder aufgegriffenen Lateinischen entsteht eine internationale Sprache, die quer über die verschiedenen Kulturen verstanden wird und einen Austausch ermöglicht.
ORF.at: Kann man sagen, dass die Verbindung weltliche Herrschaft, Kirche und Sprache eine Effizienz des Regierens gebracht hat?
Brunner: Im kulturellen Bereich ja, im liturgischen Bereich auch, aber im alltäglichen Bereich dringt die Kirche noch nicht ganz durch. Aber es gibt auch Dinge, die unter Karl nicht gelungen sind. Dieses fränkische Reich ist ein Konglomerat an Personengruppen, und diese adeligen Gruppen machen ihr eigenes Geschäft. Und über diese drüber versucht Karl, eine Verwaltungsstruktur zu legen, mit der Grafschaftsverfassung. Die Grafschaften sollten zentral kontrolliert werden durch den Missus, den Gesandten. Und das funktionierte nicht. Man konnte Führungsleute nur aus dem Adel nehmen. Und diese lokalen Adeligen machten einfach das, was aus ihrer Sicht richtig war. Das ist so wie der Streit zwischen der Zentrale Wien und den Föderalisten. Der Versuch, einen Staat im modernen Sinn zu bauen, gelingt nicht. Das Karolinger-Reich zerfällt nach Karl wieder.
Es gibt eine kulturelle Einheit, faktisch politisch setzen sich aber die regionalen Einheiten durch. Das was aber gelingt, ist der Aufbau einer Agrarstruktur. Es wird etwas eingeführt, das für die europäische Geschichte einzigartig ist: das Bauerntum. Ein Bauer ist jemand, der einen Bauernhof hat. Die Größe der Hufe ist mit ungefähr 30 Joch bemessen, ernährt eine Kernfamilie mit Mägden und Knechten. Das ist eine Einheitsgröße. Ab der Karolinger-Zeit werden nur ganze Höfe, also lebensfähige Grundeinheiten, verkauft. Und es gibt eine Trennung zwischen den Kriegern und den Bauern. Der Bauer zieht nicht mehr in den Krieg - und die Krieger müssen mit den Pferden so viel trainieren, dass sie nicht mehr Landwirtschaft betreiben.
Dieses Modell setzt sich durch. Menschen, die heute Huber heißen, sind die, deren Name sich von der Einheit Hufe ableitet. Hier ist jedenfalls eine neue Mittelschicht entstanden. Zu meiner Kindheit gab es im Mühlviertel noch Bauernhöfe, wo der beste Hof im Ort die Größe von 30 Joch hatte. Diese Sache ist so effizient, dass sie sich trotz der Tendenz zu den großen Einheiten auch noch erhalten hat. Wir wissen nicht, wie sich diese Hufenverfassung durchgesetzt hat, weil hier Dokumente fehlen, wir wissen nur, dass sie plötzlich da war.
ORF.at: Wie erklären Sie die symbolisch so wichtige Kaiserkrönung Karls im Jahr 800. Knüpft er da an antike Traditionen an – oder orientiert er sich machttechnisch mehr an Entwicklungen, die bei seinen fränkischen Vorgängern da waren, in der Verbindung von weltlicher Herrschaft und christlichem Glauben?
Brunner: Da entwickelt sich etwas wirklich Neues. Es hat in Italien Herrscher gegeben, die sich Kaiser nannten, die aber diese Idee nicht weiter entwickelt haben. Karl hatte eine Gruppe an Intellektuellen an seinem Hof, die die Idee des Kaisertums weiterspannen, also zwischen weltlich und kirchlich. Von Karl dem Großen ist der Spruch überliefert, er habe zum Papst gesagt: „Du, stell Dich hin wie Moses, hebe die Hände und bete. Den Rest erledige ich.“
Aber es gibt eine zweite Ebene. Eine der Schwierigkeiten des fränkischen Reiches ist, dass es eigentlich ein Vielvölkerreich ist, nicht nur zwischen einer romanischen und germanischen Kultur, sondern auch innerhalb dieser Kulturen. Die einzelnen Fürstentümer waren weitgehend autonom. Es ging darum, ein Herrschaftsinstrument zu entwickeln, wo man auf jeden Fall drüber steht über den regionalen Gewalten. Und das wird im Kaisertum gefunden. Das Kaisertum ist in der Folge - und da ist nicht klar, ob das schon Karl der Große selbst reflektiert hat - allen anderen Herrschaftsformen der Zeit gerade wegen der vielen Regionalkonflikte überlegen, bis 1806.
1806 wird das Römische Reich beendet, das Kaisertum noch weitergeführt, obwohl die Macht schon längst woanders liegt. Überall dort, das sieht man ab dem 19. Jahrhundert, wo polyethnische Herrschaftsformen gesucht werden, ist das Kaisertum überlegen, überall dort, wo man direkten Zugriff durch einen Herrscher sucht, kann der Kaiser nicht gut operieren.
ORF.at: Kann man sagen, dass nach Karl dem Großen der Zugriff auf den Kaisertitel die spätere Konkurrenz zwischen Frankreich und dem Deutschen Reich begründet?
Brunner: Begründet würde ich nicht sagen, aber es ist eine Folge. Es gibt einen Rex Francorum (König der Franken, Anm.), aber nie einen deutschen König, denn der deutsche König heißt immer Rex Romanorum (Römischer König, Anm.). Dass die Kaiser alle aus dem Ostreich sind, hat zur Folge, dass das französische Königtum auf der einen Seite und auf der anderen Seite jenes Königtum, das auf den Kaiser hin ausgerichtet ist, auseinander treten. Wenn man an die bis ins 19. Jahrhundert wirksame deutsche Kleinstaaterei denkt, dann ist diese polyzentrische Struktur auch im Kaisertum begründet.
ORF.at: Wie sehr könnte man sagen, hatte Karl der Große auf europäischer Ebene mit Problemen zu kämpfen, die wir heute in Europa auch kennen?
Brunner: Also man muss, will man das beantworten, mal das ganze Byzantinische zur Seite schieben. Wir haben ein lateinisches Europa mit einer sehr erfolgreichen Konzeption in Byzanz, trotz der dortigen Ups und Downs. Zufälligerweise befindet sich das byzantinische Imperium zur Zeit Karls des Großen in einer Krise – weswegen man es, ideologisch betrachtet, ignorieren kann. Dort herrschte noch dazu zu dieser Zeit eine Kaiserin. Die europäische Kultur ignoriert gerne dieses Byzantinische.
Was das Europa der künftigen Zeit maßgeblich bestimmt, ist der Umstand, dass die Herrschaftszentren Europas weit weg vom Mittelmeer liegen. Also das Mittelmeer, als Mare Nostrum, ist nicht mehr die Verbindungsklammer zwischen den verschiedenen Kulturen. Die islamische Eroberung von Teilen des Mittelmeers unterstreicht das. Karl der Große hat keine Flotte. Alle Innovationen in der Seefahrt werden im islamischen Bereich geschaffen. Wichtig ist, dass das herrschaftliche Zentrum in Europa ist, und dazu ideell in Aachen. Dabei ist das ein Zufall, denn Karl hatte einfach vom täglichen Weinkonsum, man trank ja damals ein bis vier Liter Wein am Tag, Gicht. Und in Aachen gab es warme Quellen und zum Ende seines Lebens rührt sich der Kaiser nicht mehr aus den Quellen heraus.
Ein Europa mit einem Herrschaftsbereich weit nördlich der Alpen sollte folgenreich sein für die weitere Entwicklung der europäischen Machtstrukturen. Und alle Generationen nach ihm hatten Probleme, die Entwicklungen in Italien zu koordinieren. Das bleibt ein stehendes Thema. Dieses Europa wird durch einen der brutalsten Kriege der Weltgeschichte, den Sachsenkrieg, noch entscheidend erweitert. Spätere sächsische Chronisten werden helfen, diesen Sachsenkrieg schön zu färben. Damit sollte ein wesentlicher Teil Europas den Anschluss an die universelle Kultur Europas erhalten.
ORF.at: Wenn man heute das Bild von Karl dem Großen aktiviert, aktiviert man damit ein Bild von Europa, das sich hauptsächlich auf das Verhältnis von Deutschland und Frankreich fokussiert?
Brunner: Im Prinzip ist damit die europäische Struktur politisch weitgehend vorgegeben, sogar, wenn man so will, mit einer starken Autonomie der britischen Inseln.
ORF.at: Und dass wir uns mit dem Südosten Europas heute so schwertun, könnte man das aus einer Langzeitbetrachtung auch so schließen?
Brunner: Da hätte ich eher ein Problem mit dieser Betrachtungsweise. Man sollte nicht aus einem Ergebnis auf das „Immer-schon“ schließen. Außerdem müsste man bei dieser Betrachtung die Rolle des byzantinischen Reichs und den Aufstieg des Osmanischen Reichs berücksichtigen, ohne da allzu sehr zu verkürzen.
ORF.at: Zumindest könnte man sagen, es gibt strukturelle Ähnlichkeiten zwischen Situationen der Zeit Karls des Großen und der Gegenwart.
Brunner: Ja, so formuliert, wäre das tragfähiger. Dieses Karolinger-Reich eignet sich wunderbar als Projektionsfläche. Und das beginnt ja dann doch schon mit dem 19. Jahrhundert. Es gibt bei Projektionssystemen die Sehnsucht nach einfachen Strukturen. Und das glaubt man im Karolinger-Reich zu finden.
Das Gespräch führte Gerald Heidegger, ORF.at
Link: