Ein Antiheld versinkt in sich selbst
Alles, was Ferdinand von Schirach schreibt, gerät zum Bestseller. Die Kritiker lieben ihn. Für das Debüt gab’s den Kleist-Preis, weniger bedeutende Trophäen folgten. Mit seinem letzten Buch war er für eine Gesetzesänderung in Deutschland mitverantwortlich. Das alles scheint ihn ziemlich zu langweilen, wie die fast masochistische Suche nach neuen Herausforderungen in seinem Roman „Tabu“ nahelegt.
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
Schon in seinen bisherigen Büchern hatte er sich die Latte jedes Mal ein Stück höher gelegt: „Verbrechen“ war anfangs der Versuch, ob er als bekannter Berliner Strafverteidiger literarisch reüssieren könne; danach „Schuld“ die Aufgabenstellung einer Wiederholung in noch einmal verdichteterer Form. Es folgte mit „Der Fall Collini“ der Vorstoß ins Romangenre. Dazu noch Kolumnen für den „Spiegel“. Alles gelungen, jede Hürde genommen. Auf der Suche nach würdigen Gegnern ist Von Schirach daher nun mehr denn je bei sich selbst gelandet.
Mehr als nur gekonntes Geschichtenerzählen
In „Tabu“ fordert sich Von Schirach auf mehrere Arten selbst heraus, auch auf literarischer Ebene: Bewusst verzichtet er in der ersten Hälfte des Buches auf sein bisheriges Erfolgsrezept des minimalistischen Geschichtenerzählens und entwirft stattdessen ein beklemmendes Porträt seines Antihelden Sebastian von Eschburg, der von einem Schicksalsschlag nach dem anderen durch das Leben geprügelt wird und dabei für den Leser immer mehr in seinem labyrinthischen Ich und dessen eigenen Wirklichkeiten und Wahrheiten versinkt.

Paul Ponizak
Ferdinand von Schirach
Die literarische Aufgabenstellung an sich selbst löst Von Schirach bravourös. Wirkte „Der Fall Collini“ teilweise noch wie eine Kurzgeschichte im XXL-Format, hat Von Schirach in „Tabu“ das richtige Sprachtempo für das Romanformat gefunden. Nun erlaubt er sich, seine Handlungsstränge nicht mehr wie besessen vorwärtszupeitschen, sondern lässt sich Zeit für Bilder, Szenen und Nebenschauplätze - das alles aber in der ihm eigenen Sprache: klar, scheinbar kühl und kunstvoll zum Wesentlichen destilliert.
Zwei Bücher in einem
„Tabu“ sind eigentlich zwei Bücher in einem, eingerahmt durch einen Zwischenteil und einen Epilog. Während sich Von Schirach im ersten Teil geradezu schmerzhaft tief in das Innenleben seiner Hauptfigur begibt und dabei ein - titelgebendes - Tabu nach dem anderen bricht, bekommt der Leser im zweiten Teil einen Von Schirach, wie man ihn gewohnt ist, mit einem gekonnt gestrickten Gerichtssaalkrimi über einen bestialischen sexuell motivierten Mord an einer jungen Frau. Wie schon seit den Kurzgeschichten ist es vor allem die Zeichnung der Charaktere und der Atmosphäre, die dabei beeindruckt.
Das allein reicht Von Schirach aber eben nicht. Zum einen greift er - wie bei der Frage der Sühne von NS-Verbrechen im „Fall Collini“ - einmal mehr ein brisantes politisches Thema auf, indem er aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet, was Folter bedeutet und wozu sie führt. Dabei nimmt der Autor deutliche Anleihen beim Fall der Entführung des Bankierssohns Jakob von Metzler im Jahr 2002. Die Polizei hatte dem Täter damals im Verhör Folter angedroht, um das Versteck des Buben zu erfahren - nicht wissend, dass er bereits tot war.
Nietzsche und Goya als Spielpartner
Darüber hinaus spielt Von Schirach mit sich und dem Leser über den ganzen Roman hinweg ein Spiel aus Andeutungen, Anspielungen und Verweisen; da werden die Teile des Buches zu Farben, die sich letztlich in Weiß mischen und auflösen; da geht es um Fotografie als Symbol für nur vermeintliche Wahrheit, um Schuld und Wahrheit, um Obszönität und Leidenschaft und um Nietzsche und Goya. Und da geht es wohl zu einem Gutteil auch um Von Schirach selbst - auch wenn der bekannt öffentlichkeitsscheue Autor das im ORF-Interview vehement bestreitet.
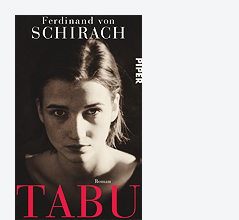
Piper Verlag
Buchhinweis
Ferdinand von Schirach: Tabu. Piper, 256 Seiten, 18,50 Euro.
Wieder einmal taucht aber in „Tabu“ etwa das Internat als prägende Erfahrung auf, was in der Biografie des Schriftstellers seine Deckung findet. Darüber hinaus findet sich im aktuellen Roman die Schilderung eines Familiensitzes, der in ähnlichen Farben gemalt ist wie das Anwesen des Industriellen Meyer in „Der Fall Collini“ und ebenso persönliche Parallelen aufweist. Es gibt noch mehr Entsprechungen aus dem persönlichen Umfeld; die Zeichnung der Vaterfigur im Roman und das Motiv des Suizids in der Familie etwa.
„Das war kein Scherz“ - oder doch?
Das Versteckspiel mit dem Motiv, wie viel Wahrheit über sich selbst der Autor in das Buch verpackt hat, dehnt Von Schirach jedenfalls bis ins wirkliche Leben aus. Am Rande eines Interviews mit dem Sender RBB im Mai kündigte er „Tabu“ indirekt als „schonungslosen Roman von Ferdinand von Schirach über Ferdinand von Schirach“ an und quittierte verlegenes Lachen des Moderators mit „Das war kein Scherz.“ Fragt man Von Schirach heute danach, geht es einem wie im Buch Sebastian von Eschburgs Anwalt Konrad Biegler: Was wahr ist, muss sich nicht unbedingt auch ereignet haben - und umgekehrt.
Lukas Zimmer, ORF.at
Links: