Immer wieder das erste Mal
Er konnte sich an seine Kindheit und Jugend erinnern und an alles, was sich in der Zeit ereignete: den Börsencrash von 1929, den Zweiten Weltkrieg. Doch er konnte sich praktisch an nichts erinnern, was sich nach 1953 - und damit in 55 Jahren seines Lebens - ereignete: Henry Gustave Molaison, jahrzehntelang zum Schutz vor der Öffentlichkeit nur als „Patient H. M.“ bekannt.
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
Weil er immer häufiger zusehends stärkere epileptische Anfälle erlitt, unterzog sich der damals 27-jährige Molaison 1953 in Hartfield, im US-Bundesstaat Connecticut, einer folgenreichen experimentellen Gehirnoperation: Der Neurochirurg William Scoville entfernte Molaison 1953 Teile der beiden medialen Temporallappen, weil er vermutete, dass die Epilepsie auf diesen Gehirnteilen beruhe. Die epileptischen Anfälle hörten tatsächlich auf.
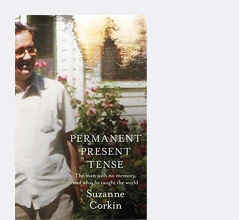
Penguin Books
Suzanne Corkin: Permanent Present Tense. Penguin, 384 Seiten, 16,95 Euro
„Er dachte, er kennt mich von der Schule“
Allerdings konnte Molaison nichts mehr im Langzeitgedächtnis speichern, also keine neue Erinnerungen mehr bilden. Sehr wohl funktionierten weiter das Arbeitsgedächtnis und das Know-how-Gedächtnis. Er konnte also nicht nur vor der Operation Erlerntes weiter anwenden, etwa sprechen, sondern lernte auch nach der Operation neue Fähigkeiten wie Golf - zugleich konnte er sich nicht erinnern, wie er es lernte. Für den Rest seines Lebens sei Molaison sich seiner eigenen Biografie nicht bewusst gewesen, so Mike Jay in der „London Review of Books“ („LRB“) über die eben auf Englisch erschienene Biografie „Permanent Present Tense“.
Gegenüber der „New York Times“ betonte die Autorin und Neurowissenschaftlerin Suzanne Corkin vom Massachussetts Institute of Technology (MIT), sie habe ein persönliches Verhältnis zu Molaison entwickelt, obwohl man denken würde, „es sei unmöglich, mit jemanden, der dich nicht erkennt“. Corkin war jahrelang Molaisons Hauptbetreuerin. Auf seine Art habe er häufige Besucher auch wiedererkannt: „Er dachte, er kennt mich von der Schule.“
„Reinheit der Störung“
Über fünf Jahrzehnte wurde Molaison zum mit Abstand wichtigsten „Forschungsfeld“ für die Neurowissenschaft. Viele grundlegende Erkenntnisse betreffend die Verbindung von Gehirnfunktion und Erinnerungsvermögen sowie in der kognitiven Neuropsychologie (sie untersucht, in welchem Verhältnis Gehirnfunktionen mit bestimmten psychischen Vorgängen stehen) verdanken sich Molaison.
Vor allem zeigte Molaison, dass explizites Gedächtnis - also bewusst angeeignetes Wissen oder Fakten - von den Temporallappen abhing, während implizites Gedächtnis - unbewusste oder spielerische Aneignung von Fähigkeiten, etwa Radfahren - unabhängig davon funktioniert. „Die Reinheit seiner Störung machte ihn zum perfekten Brennpunkt für die Untersuchung von Gedächtnismechanismen im menschlichen Gehirn“, so Corkin.
Streng abgeschirmt
Medizinisch gesprochen litt Molaison an einer anterograden Amnesie. Teilweise war auch das rückwirkende Gedächtnis beeinträchtigt. So konnte er sich kaum an die Ereignisse wenige Tage vor der verhängnisvollen Operation erinnern. Sein Kurzzeitgedächtnis funktionierte ganz normal - doch konnte er dieses Wissen nicht mehr im Langzeitgedächtnis abspeichern.
Corkin begegnete „H. M.“ erstmals 1962 und wurde nach 1980 jene Person, die ihn primär untersuchte und auch darüber entschied, welche Versuche und Psychotests an Molaison durchgeführt wurden. Sie begrenzte den Zugang drastisch und bemühte sich eigenen Angaben zufolge um strengste Geheimhaltung, um zu verhindern, dass Molaison zu einer „Attraktion“ wurde.
Mehr als 100 Wissenschaftler bekamen dennoch Zugang zu dem Mann ohne Gedächtnis, um Gehirnscans und kognitive Tests durchzuführen - doch selbst ihnen wurde nie der volle Name gesagt. Corkins Buch sei nicht nur eine Schilderung des Falls aus erster Hand, sondern fasse auch den aktuellen wissenschaftlichen Wissensstand zusammen und schildere, wie es erreicht wurde, so Jay.
„Mit mir selbst uneins“
Molaison räumte immer wieder ein, er habe „große Schwierigkeiten, sich an etwas zu erinnern“. Auf Nachfrage mutmaßte er auch, er habe möglicherweise eine Operation oder Ähnliches gehabt. Seine kurze Gedächtnisspanne führte dazu, dass er viele Dinge mehrfach wiederholte: Nicht nur sagte er die gleichen Sätze immer wieder, sondern er aß auch öfter zweimal hintereinander zu Mittag.
Doch seine Persönlichkeit war von der radikalen Veränderung nicht betroffen: Er war auch nach der Operation zuvorkommend, kommunikativ und ein im Großen und Ganzen zufriedener Mensch. Auch der Humor kam ihm nicht abhanden: Mit Fragen jenseits seines Erinnerungsvermögens konfrontiert, antwortete er häufig: „Ich bin mir mit mir selbst uneins.“ Nach seinem Tod meinte der Neurowissenschaftler Thomas Carew gegenüber der „New York Times": Wie immer man es ausdrücken will: H. M. hat einen wichtigen Teil seiner Identität verloren.“
„Dad’s dead“
Trotz all der Tests, die an Molaison durchgeführt wurden, blieben aber viele Fragen offen. So konnte nie geklärt werden, ob er sich tatsächlich an seine Träume erinnerte, wie er behauptete. Corkin mutmaßt eher, dass Molaison sich im Laufe der Zeit die Fähigkeit aneignete, Lücken in seiner Erinnerung mit Intuition und cleveren Vermutungen zu schließen. So überraschte er Corkin eines Tages damit, dass er wusste, er befinde sich in den Labors des MIT. Gab aber gleich darauf zu, dass er das von der Aufschrift auf einem T-Shirt eines vorbeigehenden Studenten abgeleitet habe.
1977, nach dem Tod seines Vaters bemerkte man, dass Molaison in seiner Geldtasche eine handschriftliche Notiz „Dad’s dead“ („Papa ist tot“) aufbewahrte, um sich das Gefühl, das dessen Abwesenheit immer wieder auslöste, erklären zu können.
Umstrittene Operation
Corkin räumt ein, dass zum Zeitpunkt der Operation die Gefahren von Psychochirurgie bereits sichtbar waren, warnt aber vor eine Verurteilung im Nachhinein: „Scoville rettete immerhin Henrys Leben, auch wenn er ihm das Gedächtnis wegnahm.“
53-stündige Sezierung
Molaison lebte zunächst bei Verwandten, ab seinem 54. Lebensjahr lebte er in einem Pflegeheim in Windsor Locks, wo er auch noch im Alter an weiteren Studien teilnahm. Eine seiner liebsten Beschäftigungen war das Lösen von Kreuzworträtseln. Nach seinem Tod wurde eine lange zuvor sorgfältig geplante logistische Operation durchgeführt: Molaisons Leichnam wurde rasch zu einem Kernspintomografen gebracht, wo zahllose Aufnahmen seines Gehirns gemacht wurden, dann wurde rasch im Spital eine Autopsie durchgeführt. 53 Stunden lang wurde sein Gehirn seziert und in zahlreichen Scheiben tiefgefroren zur mikrosopischen Untersuchung präpariert.
In ihrem Nachruf 2008 beschrieb Corkin Molaison als humorvollen Menschen, der einen entscheidenden wissenschaftliche Beitrag geleistet habe: „Seine Tragödie wurde zu einem Geschenk für die Menschheit. Es ist eine Ironie des Schicksals, dass er nie vergessen werden wird.“
Links: