Haltung und Himmelfahrtskommando
„Bankraub“, „kalte Enteignung“ und die Ausbreitung eines sich als „politischen Vegetarismus“ tarnenden deutschen „Empires“ (so ein Kolumnist des konservativen britischen „Telegraph“) - das sind nur ein paar Schlagworte, die seit der ersten gescheiterten Zypern-Rettung in der Nacht vom 15. auf den 16. März in Umlauf sind.
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
Selbst als der Rettungsplan, der auch die kleinen Spareinlagen auf zypriotischen Banken mit in den Sanierungsplan einbeziehen wollte, Geschichte war (und das war er in Bezug auf die Kleinsparer schon Stunden nach der verkündeten Einigung), ging die Suche nach dem Schuldigen, der sich an den Ersparnissen des „kleinen Mannes“ vergriffen hatte, weiter: War es der deutsche Finanzminister, den man als Regelwerk- und Austerität-Beckmesser porträtierte? War es der unerfahrene junge Vorsitzende der Euro-Gruppe? Oder am Ende doch der zypriotische Präsident, der die Kleinsparer mit in die Pflicht nahm, wissend, dass dieser Plan niemals umsetzbar gewesen wäre?
Die Pandora-Büchse war geöffnet
Unter der Headline „A Cyprus whodunit“ beschrieb ein US-Beobachter die Art, wie sich Europa in der dritten März-Woche 2013 zerfleischte. Euro-Gruppe-Chef Jeroen Dijsselbloem übernahm in besagter Woche vor dem EU-Parlament die politische Verantwortung dafür, dass man die Pandora-Büchse einer Spareinlagendebatte auf EU-Ebene eröffnet hatte (das war noch Tage vor der finalen Zypern-Rettung und der nächsten Schelte für Dijsselbloems Auftreten in der Öffentlichkeit).
Und blickt man auf die vielen Journalisten, die nach Zypern gereist waren, um die dortige Bevölkerung zu fragen, wie sie sich nach den Rettungsmanövern und im Angesicht geschlossener Banken denn fühle, durfte man wohl keine positiven Reaktionen erwarten. Ein Bild verfestigte sich - und Ursachen und Wirkung schienen binnen weniger Tage vertauscht.

Reuters/Yannis Behrakis
Nicht nur in Nikosia schiebt man den Schwarzen Peter bei der Zypern-Rettung Deutschland in die Schuhe und bemüht alte Ressentiments
Da konnte die darauffolgende Zypern-Rettung nichts verbessern. Die Debatten gingen weiter: Wie sehr durfte und darf man eine Rettungsaktion, die den Verursacher mit einbezog, als „modellhaft“ bezeichnen? Und wie viel ist das Versprechen von Politikern wert, die Spareinlagen als sicher proklamierten?
Erinnerungen an den Oktober 2008
Steffen Seibert, der Sprecher der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, wurde in der laufenden Zypern-Debatte gefragt, wie sehr das Versprechen von Merkel und ihrem damaligen Finanzminister Peer Steinbrück aus dem Herbst 2008, dass deutsche Spareinlagen im Gefolge der Lehman-Pleite sicher seien, noch gelte. „Es ist das Merkmal einer Garantie, dass sie gilt“, bemühte Seibert die Logik des Politischen.
Buchhinweis
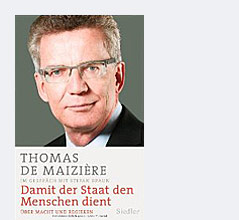
Siedler Verlag
Einblicke in Hintergründe von Entscheidungen im Kabinett von Angela Merkel: Thomas de Maiziere, Stefan Braun: Damit der Staat den Menschen dient. Über Macht und Regieren, Siedler, 284 Seiten, 23,70 Euro.
Der Oktober 2008, er war der Zypern-Krise so unähnlich nicht - wenngleich von ungleich größerer Systemrelevanz. „Die Lehman-Pleite kam nicht ganz aus heiterem Himmel“, sagt einer, der damals an der Krisenbewältigung ganz eng beteiligt war. Es ist der heutige deutsche Verteidigungsminister Thomas de Maiziere (CDU), damals Chef des Kanzleramts in Berlin.
De Maizieres freimütige Beschreibung zeigt, wie rasch die Politik zu Handlungen gezwungen sein kann und dabei vor allem Haltung einnehmen muss - ohne immer die Tragweite von Entscheidungen abschätzen zu können. De Maizieres Aussagen sind frisch und entstammen einem eben erst erschienenen Interviewband des deutschen Journalisten Stefan Braun (siehe Buchhinweis).
Einer Art „siebten Sinn folgend“ habe er sich damals am 5. Oktober eine Stunde früher als geplant im Kanzleramt in Berlin eingefunden: „Kaum war ich da, kam die Frage auf, ob wir den Menschen versprechen, dass ihre Einlagen sicher seien.“ Es habe in diesem Moment noch gar keine große strategische Überlegung gegeben. Man wollte eher eine Antwort auf Informationen der deutschen Bundesbank finden, wonach Menschen im Gefolge der Lehman-Pleite (und der danach folgenden Hypo-Real-Estate-Krise) verstärkt Geld via Bankautomaten abhoben.
Zwei Denkschulen
„Die eine Denkschule empfahl: Wir beruhigen und sagen, dass das alles nicht so schlimm ist. Die andere riet: Wir garantieren Spareinlagen, um Sicherheit zu geben.“ Am Ende sei es eine Führungsentscheidung von Merkel und Steinbrück gewesen, auf die zweite Variante zu setzen. „Höchst riskant! Sicher eine der schwersten politischen Entscheidungen. Es ist gut gegangen. Grandios. Aber es war nicht komplett zu Ende gedacht“, resümiert De Maiziere im Gesprächston.

APA/EPA/Rainer Jensen
Das Spareinlagenversprechen von Merkel und Steinbrück im Oktober 2008: „Da war vieles nicht zu Ende gedacht.“
Der Zeitdruck einer Verkündung sei sehr groß gewesen, man wollte die Aussage in den großen Sonntag-Hauptnachrichten platzieren, damit die Botschaft die Adressaten erreichte. Merkel und Steinbrück seien „ziemlich betreten“ dagestanden, „aber damit war auch klar, dass da nichts inszeniert war: Dass die beiden so unbeholfen dastanden, war unbeabsichtigt, aber Teil der positiven Wirkung.“
Nachfragen und fehlende Antworten
Als dann die Sache „im Kasten“ gewesen sei, kamen schließlich Journalistenfragen auf: „Was genau ist eine Einlage, was garantieren wir da?“ Der erste Gedanke sei gewesen: „Na Sparbücher!“ Doch die Nachfragen gingen weiter: Ob auch Aktienbesitz zu den „Einlagen“ zähle. „Unsere spontane Antwort darauf: Wir können doch nicht den Kurs von Aktien garantieren!“
All die Fragen, die schließlich im Hintergrund auftauchten, hätten, so De Maiziere, gezeigt, „dass das nicht bis ins Detail vorbereitet war und auch nicht vorbereitet sein konnte. Es war eben nicht Teil einer längeren strategischen Überlegung gewesen. Es entsprang den Sorgen an diesem Tag.“
In der folgenden Nacht habe man entsprechende Zahlen zu kalkulieren versucht - und auch da die Erkenntnis: Bevor man eine falsche Zahl nenne, nenne man lieber gar keine Zahl. Hätte man alles durchgerechnet gehabt und das vor der Öffentlichkeit präsentiert, dann wären auch panikartige Verkäufe neben anderen Anlageverschiebungen nicht auszuschließen gewesen: „Das hatte auch einen Teilerfolg zunichtegemacht. Ja, das war Können und Glück hoch drei“, so De Maiziere.
„Es zählt nicht nur Expertenwissen“
Entscheidend, so rekapituliert der Politiker, sei die „Haltung“ gewesen. Die Bevölkerung vertraue in einer Krisensituation am ehesten einer Person, die in der Öffentlichkeit vermitteln könne: „Ich bin fleißig. Ich gebe mir Mühe.“ Man könne auch danebengreifen, so De Maiziere, als Erkenntnis bleibe bei ihm aber, dass man in „einer Extremsituation eben nicht nur Expertenwissen“ umsetze.
„Wenn die Politik aus den Ereignissen der vergangenen Tage eines gelernt hat, dann, dass es einem Himmelfahrtskommando gleicht, wenn man auch nur darüber nachdenkt, Spareinlagen unter 100.000 Euro anzutasten“, kommentierte Frank Stocker jüngst in der „Welt“.

AP/Virginia Mayo
Nicht immer hatte Jeroen Dijsselbloem viel zu lachen in den letzten Wochen - Europa mit ihm auch nicht
Neue Krisen, alte Erinnerungen
Wie schnell ältere Versprechen im Licht wackeliger Verhandlungsvermittlung unter Druck kommen, zeigte letztlich die Woche der Zypern-Rettung Mitte März. Europa bescherte sich nicht nur eine bis auf den Tag wirkende Debatte über die Sicherheit der Spareinlagen. Dabei hatten manche ja durchaus eine gewisse Didaktik erwartet: Erstens, weil in die Gleichung Bankenrettung = Staatenrettung ein Keil getrieben wurde. Zweitens, weil man den Verursacher der Krise mit in die Pflicht der Lösung genommen hatte.
So blieb es bis jetzt Kommentatoren vorbehalten, von der Modellhaftigkeit der Zypern-Rettung zu sprechen. Dass Euro-Gruppen-Chef Dijsselbloem die Vorbildwirkung der Zypern-Frage zu betonen wagte, wurde ihm umgehend zum Verhängnis. Dabei wollte er Ähnliches sagen wie die deutsche Kanzlerin vor ihm: „Seid euch im Klaren darüber, wenn Banken in Probleme geraten, kommen wir nicht automatisch, um sie zu lösen“ (O-Ton Dijsselbloem zur „Financial Times“). Merkel hatte im Licht gemachter Erfahrungen für ein ähnliches Signal lieber den Blick zurück gewählt: „Ich halte das gefundene Ergebnis für richtig. Es nimmt diejenigen, die die Fehlentwicklung zu verantworten haben, mit in die Haftung.“
Eigentlich, so erinnert Christian Siedenbiedel in der aktuellen „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ („FAS“), habe man in der Zypern-Krise doch das gemacht, was immer alle gefordert hatten: Die Gläubiger der Banken (das seien leider nun auch die Sparer) an den Kosten der Bankenpleiten zu beteiligen: „Die Idee, so könnte man es künftig immer machen, ist alles andere als abwegig. (...) Zum ersten Mal seit Beginn der Eurokrise wurde der unheilvolle Zyklus aus Banken- und Staatenrettung wirksam durchbrochen. Bislang wurden Banken, die sich verspekuliert hatten, immer von ihren jeweiligen Staaten aufgefangen. Daraufhin gerieten die Staaten selbst in Schieflage. Und mussten sich von den anderen Euroländern herauspauken lassen.“
Europa habe sich in die „Post Solidarity Era“ begeben, steht nun zu lesen. Es ist just der internationale Bankenverband IIF, der diese Befürchtung äußert. Man darf hellhörig bleiben.
Gerald Heidegger, ORF.at
Links: