Unabhängigkeitstraum und Kriegstrauma
Der Unabhängigkeitskrieg für die Juden, die „Nakba“ (Katastrophe) für die Palästinenser: Das Jahr 1948 ist tief in das kollektive Gedächtnis im Nahen Osten eingeschrieben und bestimmt bis heute das Geschehen. Doch der Krieg war vor allem ein schicksalshaftes Ereignis für Millionen Menschen.
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
Der israelische Autor Yoram Kaniuk, der im Unabhängigkeitskrieg bei entscheidenden Schlachten dabei war, blickt mehr als 60 Jahre danach auf die Ereignisse zurück. Der nunmehr 83-jährige Kaniuk rührt an Tabus, indem er seine ganz persönlichen Erlebnisse erinnert und sich nicht um Objektivität kümmert, ja selbst offen daran zweifelt, ob die erwähnten Fakten in allen Details stimmen. Damit gelingt es ihm wie kaum einem Autor zuvor, jene Gefühls- und Gedankenwelt fassbar zu machen, in der er und seine Kameraden gefangen waren - und, von den Kriegsereignissen traumatisiert, teilweise bis heute sind.
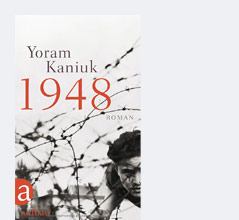
Aufbau Verlag
Buchhinweis
Yoram Kaniuk: 1948. Aufbau, 248 Seiten, 19,99 Euro.
Verlust der Unschuld
„1948“ - nun ins Deutsche übersetzt - ist eine bittere, aber vom Verständnis des 80-Jährigen mit seinem 17-Jährigen Ich getragene Seelenerforschung. Die Bitterkeit rührt daher, dass Kaniuk sich selbst eingestehen muss, dass viele Ideale und Träume im Zuge des Aufbaus des Staates kaputtgingen. Das gesamte Buch ist von der schmerzhaften Erkenntnis durchzogen, dass selbst der Kampf für eine gerechte Sache Unrecht erzeugen kann. In anderen Worten, dass die Errichtung einer sicheren Heimat für Juden drei Jahre nach dem Holocaust mit der Vertreibung Hunderttausender Palästinenser aus ihren Dörfern und Städten einherging. Eine Tatsache, die einzusehen und zuzugestehen noch heute vielen Israelis schwerfällt.
Grausamkeit, Betrug und dem durch die Wucht des Kriegs erzeugten Unwillen, das moralisch Richtige zu tun, stehen die erlebte Kameradschaft, die unbedarfte Abenteuerlust und das intensive Lebensgefühl gegenüber. Es sind Geschichten, die einem den Atem stocken lassen, die einen zu Tränen rühren, ob ihrer Absurdität aber auch zum Lachen bringen.
Die „tiefe Schramme“ der Schuld
Eine der dramatischsten Episoden ist jene, als Kaniuks Einheit in ein verlassenes palästinensisches Dorf einmarschiert und ein Kamerad dort seinen besten Freund verstümmelt auf einem Baum aufgehängt findet. Kaniuk schildert, wie der Kamerad daraufhin zur blinden Rache schreitet und zwei Araberinnen, die er noch in einem der Häuser findet, misshandelt. Kaniuk versucht den Kameraden, „den ich vorher und nachher geliebt habe“, zu stoppen. Doch es endet damit, dass er selbst zum Schuldigen wird, indem er den plötzlich hinzueilenden kleinen Sohn der jüngeren Frau erschießt - obwohl er auf den Kameraden zielte.
In einem Epilog, der in der hebräischen Erstausgabe noch fehlt, schildert Kaniuk, erst nach Erscheinen seines Buches sei ihm klargeworden, dass seine Schilderung nicht stimmt. Er habe vielmehr auf seinen Kameraden geschossen, ihn jedoch verfehlt und dieser selbst habe den Buben getötet. „Die Schuld hat eine tiefe Schramme bei mir hinterlassen. Jetzt erst erkenne ich, welche Strafe ich mir auferlegt habe, als ich schrieb, ich hätte das Kind erschossen.“
Rettung und „Schabbes“
Kaniuk schildert etwa, wie es seiner Einheit unter abenteuerlichen Umständen gelang, einen Lebensmittelkonvoi in den belagerten jüdischen Teil von Jerusalem zu bringen. Dort wurden sie mit Begeisterung empfangen. Doch in den jüdisch-orthodoxen Vierteln schrien die Orthodoxen zornig „Schabbes“ und schleuderten Steine auf die Soldaten - weil sie den Schabbat entweiht hatten. Einer von Kaniuks Kameraden wurde so wütend, dass er einen der Orthodoxen packte und ihn mit den Worten „Das wird dich lehren, was Schabbes bedeutet“ prügelte.
Kaniuk schont niemanden, am wenigsten sich selbst. Immer wieder wundert sich der 80-Jährige darüber, wie naiv er und seine Kameraden damals waren. Den Krieg schildert er als grausames Chaos: „Einer rief mir etwas zu, vielleicht kannte er mich, und dann starb er. Ein anderer blutete, das Blut lief ihm in den Mund. Jeder hielt seine Handgranate fest, um nicht in Gefangenschaft zu fallen.“
„Ich wurde gleichgültig“
Kaniuk macht sich auch Selbstvorwürfe, weil er die Vertreibung der Palästinenser hinnahm, ohne dagegen aufzubegehren. Die Leere von Ramla (bis 1948 eine arabische Stadt, die Palästinenser „flüchteten“ und wurden an der Rückkehr gehindert, Anm.) „machte mich traurig, und angesichts der Kriegsgräuel, die ich kurz zuvor erlebt hatte, ließ es mich nicht kalt. Doch zu meiner Schande war ich noch nicht zu richtigem Zorn imstande. Ich war jung. Ich sah Kameraden sterben. Ich sah von beiden Seiten verübte Gräueltaten, ich wurde gleichgültig, ich fühlte mich so, als hätte ich keine Gefühle.“
Kaniuk schildert, wie Holocaust-Überlebende nach Ramla gebracht wurden und wie sie rücksichtslos die Häuser in Besitz nahmen, während die arabischen Bewohner das durch einen Maschendrahtzaun aus der Entfernung mitansahen. Die Brutalität habe ihn abgestoßen, so Kaniuk, zugleich zeigt er Verständnis für das Verhalten der Holocaust-Überlebenden.
Die zertrümmerte Bach-Fuge
In einer der berührendsten Episoden erzählt Kaniuk, wie ihm eine Frau während des Kriegs die Schallplatte von einer Bach-Fuge, die Kaniuks Lieblingsmusik war, gab. Diese hatte ihrem bei einem arabischen Überfall ermordeten Mann gehört, einem Geiger, der aus Österreich auf abenteuerlichen Wegen vor den Nazis geflüchtet war und trotz gebrochener Hand die Platte durch alle Kriegswirren bis nach Palästina rettete. Als Kaniuk die Platte immer wieder anhörte, regte das seine Kameraden so sehr auf, dass sie die Platte einfach zertrümmerten.
„Wir waren dumme Kinder“
Immer wieder spricht Kaniuk das verbreitete Unverständnis für die Holocaust-Überlebenden im eben entstehenden Israel an. Kaniuk selbst schreibt, er habe sie zuerst „gehasst“, später habe er sich in sie „verliebt“. Im Nachhinein sieht er, der nach seiner Kriegsverwundung auf einem Schiff arbeitete und dabei half, Tausende Holocaust-Überlebende nach Israel zu bringen, darin eine nicht wiedergutzumachende Schuld.
Er selbst wuchs, so wie alle Zabres (die nicht eingewanderten, in Palästina/Israel geborenen Juden, Anm.), mit dem zionistischen Ethos und Pathos vom harten Aufbau und der heldenhaften Verteidigung der Heimat auf - und die Holocaust-Überlebenden galten ihnen als das abschreckende Beispiel, wie sie nicht sein wollten - „von Angst gebeugt und hässlich wie Juden - das ist es, was wir sagten. Wir waren dumme Kinder.“
Ein „Micky-Maus-Krieg“
Und dazu die späte Erkenntnis: Der Unabhängigkeitskrieg sei ein „Micky-Maus-Krieg“ gewesen im Vergleich zu dem, was die Holocaust-Überlebenden durchmachen mussten. Die im Aufbau befindliche israelische Gesellschaft wollte sich mit diesem Thema nicht auseinandersetzen - erst infolge des Eichmann-Prozesses 1961 wuchs langsam ein Verständnis für die Holocaust-Überlebenden heran.
Mit der Beschreibung der Ermordung eines kleinen Buben, der Vergewaltigung von Frauen, des Dealens mit Haschisch und mit archäologischen Wertgegenständen, die bei der Vertreibung der muslimischen Bevölkerung aus Cäsarea gefunden wurden, und mit der teilweise scharfen Kritik an der Führungsebene hämmert Kaniuk zudem wütend auf eine aus seiner Sicht falsche Glorifizierung der Eliteeinheit Palmach, in der er kämpfte, ein.
Im Strudel der Erinnerungen und Gefühle
Ein klarer und scheinbar simpler Stil ist Kaniuk von jeher eigen. Doch in „1948“ werden Sprache und Syntax so spröde und durchlässig, dass der Text kaum noch schützend zwischen dem Leser und den Geschehnissen und deren Akteuren steht. Kaniuk überwältigt mit Hauptsatzkaskaden und einer drastischen Reduktion von Adjektiva. Dazu kommt ein betont unepischer Stil, die Erzählung wird immer wieder durch zeitliche Sprünge, Reflexionen und Zweifel am eigenen Erinnerungsvermögen gebrochen.
Es klingt einerseits, als würde Kaniuk dem Leser im persönlichen Gespräch seine Geschichte erzählen. Andererseits erinnert es in der maximalen sprachlichen Reduziertheit phasenweise an die hebräische Bibel. Ruth Achlamas Übersetzung bleibt - auch in der Hölzernheit - so nahe wie möglich am hebräischen Original. „1948“ ist bewusst kein schön geschriebenes Buch, aber voller Klarheit, und es reißt den Leser unweigerlich mit in den Strudel an Erinnerungen, Träumen und Gefühlen im Schicksalsjahr 1948.
Guido Tiefenthaler, ORF.at
Links: