Priviligiert und isoliert
Mitsuko Aoyama war ein wohlerzogenes japanisches Mädchen, dessen Weg vorgezeichnet schien. Doch das ausgehende 19. Jahrhundert bescherte ihr ein anderes Schicksal - das einer Adeligen im Österreichisch-Ungarischen Kaiserreich. Ihre Enkelin Barbara Coudenhove-Kalergi erinnert in einem Buch an die sagenumwobene Großmutter.
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
Es gibt wenige Menschen wie die Journalistin Coudenhove-Kalergi. Gemeinsam sind ihnen unzureichende Bezeichnungen wie „Gewissen der Nation“, „beredte Zeitzeugen“ oder „intellektuelle Mahner“. In der ersten Hälfte ihrer Autobiografie „Zuhause ist überall“ erzählt sie die Geschichte ihrer Familie - deutschsprachige Adelige aus Tschechien, die zu Ende des Zweiten Weltkriegs vertrieben wurden und sich in Österreich niederließen.
Es ist Coudenhove-Kalergis unbestechlicher journalistischer Blick, der die kleinen und großen Geschichten des Buches zu mehr macht als einer High-Society-Adelsbiografie. Warmherzig, aber nie belanglos, berichtet sie von der priviligierten und gleichzeitig isolierten Stellung ihrer Familie in Tschechien vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Sie und ihre Standesgenossen seien wohl „ein Überbleibsel“ der vornationalen Epoche des 18. Jahrhunderts gewesen, schreibt Coudenhove-Kalergi.

Privat
Mitsuko mit ihren Kindern um 1900: wie die Orgelpfeifen
Ein Beispiel misslungener Integration
Diese Isolation galt umso mehr für ein Mitglied der Familie, das von weit her eingeheiratet hatte: Mitsuko Aoyama, die japanische Großmutter von Barbara Coudenhove-Kalergi. Sie war das, schreibt die Chronistin der Familienhistorie, was man heute als Beispiel einer misslungenen Integration bezeichnen würde. Ihr bewegtes, wenn nicht tragisches Schicksal ist in Japan wohlbekannt.
Erst 2011 wurde ihr ein Musical gewidmet, es gibt Filme, eine Fernseh- und eine Mangaserie über ihr Leben. Ein Leben, schreibt Coudenhove-Kalergi, das nicht besonders glücklich verlaufen sein dürfte. Begonnen hatte alles mit dem Sturz eines Pferdes. Heinrich Coudenhove-Kalergi residierte in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts als Geschäftsträger in der Gesandtschaft des Kaisers in Tokio. Eines Tages verletze er sich beim Reiten vor einer Antiquitäten- und Kunsthandlung.
Beginn einer Liebe wie im Märchen
Fasziniert, sie hatte noch nie einen Ausländer gesehen, half ihm die Tochter des Besitzers auf - und eroberte sein Herz. Immer wieder besuchte der Adelige fortan das Geschäft und kaufte dort ein. Schließlich beschäftigte er Mitsuko in der Gesandtschaft, sie wurde seine Konkubine. Heinrich sprach Japanisch, hatte sich viel mit japanischer Geschichte beschäftigt, und jetzt kam noch die Liebe hinzu: Obwohl als Ältester für das Erbe vorgesehen, sagte er seinen Brüdern, dass er lieber in Asien bleiben wolle.
Also bereitete sich der Zweitgeborene auf sein Leben als Familienoberhaupt am Familiensitz Ronsperg im Westen Tschechiens vor. Doch nach dem Tod des Vaters barg dessen Testament eine Überraschung für alle: Als Nachfolger hatte er wider Erwarten den erstgeborenen Sohn seines erstgeborenen Sohnes vorgesehen. Heinrich und Mitsuko hatten zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Kinder, beides Buben.

Privat
Mitsuko in Wien (1912)
Abreise mit dem „fremdländischen Teufel“
Hier beginnt jener Teil der Geschichte, der „Lady Mitsuko“ für Japaner so unvergesslich macht. Sie ging infolge der Öffnung Japans Richtung Westen als eine der ersten Frauen nach Europa - und dann noch als ehrwürdige Adelige. Vor ihrer Abreise wurde sie sogar noch von der japanischen Kaiserin empfangen - „eine große Ehre“, wie Coudenhove-Kalergi schreibt. Mitsukos Vater freute sich weniger über die rasch vollzogene Hochzeit mit dem „fremdländischen Teufel“ und über die katholische Taufe seiner Tochter, aber er ließ sich durch eine großzügige finanzielle Zuwendung milde stimmen.
Mitsukos Enkelin spricht in ihrem Buch von einem „Kulturschock“. Als Angehörige einer angesehenen Familie war sie während ihrer Jugend minutiös auf ein Leben als Frau in Japan vorbereitet worden - kaum etwas davon kann sie nun brauchen. Von Anfang an fühlt sie sich von feindlichen Blicken verfolgt. Erst in Ronsperg lernt sie Deutsch.
Die eigenen Kinder wurden zu Fremden
Coudenhove-Kalergi zitiert aus Mitsukos Tagebuch, das von einem japanischen Fernsehteam in Ronsperg aufgestöbert worden war. Darin gibt die einsame, stets vollendet gekleidete Dame ein Gespräch mit ihrem Sohn Hansi wieder. Dieser fragt etwas, aber sie kann wegen noch mangelhafter Deutschkenntnisse keine Antwort geben: „Da trifft mich ein verächtlicher Blick. Ein Blick aus blauen Augen. Den Augen eines Fremden.“ Nicht einmal die eigenen Kinder sind ihr Heimat.
Am liebsten bringt sie ihrem Gatten Tee und sieht ihm zu, wie er beim Schreibtisch sitzend arbeitet. Von Heinrich Coudenhove-Kalergi ist etwa die Studie „Das Wesen des Antisemitismus“ überliefert. Sigmund Freud sollte es später eines der besten Bücher nennen, die je zu diesem Thema erschienen sind. Heinrich tritt für religiöse Toleranz ein. In Ronsperg verkehren Muslime, Juden und Christen genauso wie die ursprünglich buddhistische Mitsuko.
Gedenken in Mödling
In Mödling erinnert man sich aktiv an Mitsuko: Dort wurde ein Zengarten zu ihrem Angedenken errichtet. Auch im Mödlinger Museum wurde eigens eine Gedenkvitrine eingerichtet. Nach Mödling kommen japanische Touristen gerne, um Mitsukos Spuren zu folgen.
Verschanzt in Mödling
Nur: Heinrich, die Integrationsfigur, starb 1906 an einem Herzinfarkt, noch bevor er 50 Jahre alt war, und hinterließ seine Frau mit sieben noch kleinen Kindern und der Verantwortung für das Familienerbe. Die Familie sprang ein und half. Aber obwohl Mitsuko, wie auf Wikipedia nachzulesen ist, neben Deutsch auch Französisch, Mathematik und Geografie lernte und schließlich Jus und Wirtschaft studierte, scheint sie nie in der Mitte der Gesellschaft angekommen zu sein.
In Japan gilt sie als feministische Pionierin, schreibt Coudenhove-Kalergi, die einmal von jungen japanischen Journalistinnen über die Großmutter ausgefragt worden war. Sie habe sich nicht um Konventionen gekümmert und sei einfach der Liebe halber nach Europa gegangen. Die Realität jedoch dürfte weit weniger glanzvoll gewesen sein. Nachdem der älteste Sohn sein Erbe angetreten hatte, zog Mitsuko zu ihrer ältesten Tochter nach Mödling, wo sie bis zu ihrem Tod während des Zweiten Weltkrieges zurückgezogen lebte - immer „japanischer“ werdend, wie ihre Enkelin anmerkt.
Die Familiengeschichte ist zu diesem Zeitpunkt längst ohne Mitsuko weitergelaufen. Coudenhove-Kalergi erzählt sie so nach, dass man davon auch eine Geschichte des 20. Jahrhunderts in Mitteleuropa ableiten kann. Neben dem journalistischen Blick und den sehr persönlichen Geschichten über ihre Kindheit, ihr Leben und ihr Lieben ist es auch die adelige Herkunft, die das Buch spannend macht.
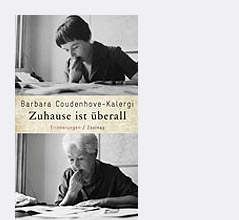
Paul Zsolnay Verlag
Barbara Coudenhove-Kalergi: Zuhause ist überall. Erinnerungen. Zsolnay, 335 Seiten, 22,90 Euro.
Bauern, Bürger, Adelige
In den großen Schicksalsmomenten überschneiden sich die Geschicke der Adeligen und Normalsterblichen. Beide kämpfen im Krieg. Beide müssen die Entscheidung treffen, ob sie sich den Nazis anschließen oder nicht - hier wie dort verläuft die Trennlinie quer durch Familien. Und bei der Vertreibung aus Tschechien nach dem Zweiten Weltkrieg marschieren Bauern, Bürger und Adelige Seite an Seite Richtung Österreich. Eine Decke und ein Taschenmesser hatte die 13-jährige Coudenhove-Kalergi bei sich. Mehr war der Familie nicht geblieben.
Dann trennen sich die Wege wieder. Die Familie muss nicht wie andere bei null anfangen. Es gibt einen Bauernhof in Salzburg, den der Großvater zur Jagd genutzt hatte. Im Nachhinein kann eine Kiste mit Silbergeschirr gerettet werden, dessen Verkauf über die erste Zeit hinweghilft. Die gute Erziehung, die Bildung und vor allem das „Netzwerk“ sorgen dafür, dass die Familie wieder auf die Beine kommt.
Gegen die Dummheit
Coudenhove-Calergi wird zu einer Journalistin, die ihren eigenen Kopf hat. Auf vielen Stationen, von der konservativen „Presse“ über die linke „Arbeiterzeitung“ bis zum ORF gibt sie das humanistische Erbe ihres Großvaters weiter. Ein wenig verwundert zeigt sie sich auf die Anfrage von ORF.at, ob aus ihrem Buch ausgerechnet die Geschichte ihrer Großmutter aufgegriffen werden darf.
Aber schließlich steht Coudenhove-Kalergi als Journalistin seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit und kommentiert mit hohem moralischem Anspruch genauso wie mit Verve das Zeitgeschehen, immer eine Lanze für Toleranz und gegen Dummheit brechend. Sie und das von der ersten bis zur letzten Seite packende Buch sprechen für sich selbst. Ihre Großmutter hingegen ist in Österreich weitgehend unbekannt, eine postume Integration tut Not.
Simon Hadler, ORF.at
Links: