Ekstase statt Exegese
Bob Dylan ist ein Spieler - und das bereits seit langem. Er spielte bereits kurz nach seinem fulminanten Karrierebeginn mit Erwartungshaltungen. Seine Einsätze waren Zitate, Ironie, bisweilen tiefe, ernst gemeinte Gefühle - und dann wieder blanker Nonsens. Zum Nachhören sei allen Interessierten sein Album „The Basement Tapes“ empfohlen.
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
Die Aufnahmen zu der Platte entstanden 1967, nachdem Dylan sich zunehmend von seinem Publikum entfremdet hatte. Der Folk-Bewegung in Greenwich Village und ihren Jüngern galt er als Beelzebub, seit er, ein typischer Schachzug Dylans, 1965 ausgerechnet beim Newport Festival und für viele ohne jede Vorwarnung in engen Jeans, mit Lederjacke und E-Gitarre aufgetreten war. Es folgten in den beiden Jahren danach legendäre Konzertauftritte, in denen „Judas“ noch das Netteste war, was Dylan neben Buhrufen und Pfiffen auf der Bühne entgegenschallte.
Herumhängen in „Big Pink“
1967 gönnten sich er und seine Begleitband The Hawks, die sich in The Band umbenannte, eine Auszeit. Im Sommer und Herbst des Jahres hingen die Musiker miteinander herum, wurden von Freunden wie Johnny Cash besucht, jamten, spielten alte Blues-, Country- und Folksongs nach und schrieben schließlich einige neue Lieder. Begonnen hatte man in Dylans rot gestrichenem Zimmer in Woodstock, aber schon bald übersiedelten sie in „Big Pink“, das Haus eines Bandmitglieds. Dort hatte dieser im Keller für die Band Peter Paul & Mary ein recht ordentliches Studio eingerichtet, das gerade frei war. Das Tonbandgerät lief fortan mit.
Bootleg-Manie als Mythenunterfutter
In den paar Monaten entstanden Aufnahmen von über hundert Songs, jeweils in mehreren Versionen. Selbst vom spontanen Zusammenspiel und dem Erarbeiten der Lieder legen Bänder Zeugnis ab. Sowohl Dylan als auch The Band verwendeten später einzelne Songs in ihren Alben, aber die „Basement Tapes“ sollten eigentlich nicht als solche veröffentlicht werden. Dafür überschwemmten zahllose Bootlegs den Schwarzmarkt und steuerten viel Material zur Legendenbildung rund um Dylan bei.
Als dieser schließlich 1975 doch noch der Veröffentlichung von 24 der Songs unter dem Titel „The Basement Tapes“ zustimmte und das Album die Charts hochkletterte, soll Dylan sich gewundert haben: „Ich dachte, die Aufnahmen hat ohnehin schon jeder.“ Dokumentiert wurde die Entstehungsgeschichte der Platte vom obersten Dylanologen aller Zeiten und Länder - Greil Marcus. Nun liegt sein Buch über die Monate im „Big Pink“ in einer neu überarbeiteten Fassung auf Deutsch vor.
Höhere Dylanologie
Greil Marcus hatte bereits auf dem Innencover der Originalausgabe der „Basement Tapes“ einen Kommentar mitgeliefert, damals noch knapp und auf das Bauchgefühl der Hörer abzielend. Manches, was später über diese Songs und überhaupt über Dylan veröffentlicht wurde, ist an Absurdität nicht zu übertreffen. Es fehlte gerade noch, dass sie Dylans Zahnarzt darüber befragten, welche Zeitschrift er im Wartezimmer gelesen hatte, um dann Rückschlüsse zu ziehen, weil in einem Artikel darin von „Acapulco“ die Rede war und man deshalb den Song „Goin’ to Acapulco“ vollkommen neu interpretieren müsse.
Der Meister des Schwachsinns
Dylans Volten in der Lebensführung, in seiner Musik und in seinen Lyrics liefern, ganz nach postmoderner Manier, genügend Flächen, auf denen bei viel Interpretationsspielraum um die Deutungshoheit gerungen werden darf. Mit Dylan selbst, darf man vermuten, hat das nicht mehr allzu viel zu tun. Auf dieses Glatteis führte und führt er Verehrer und Journalisten wohl mit Absicht - zumindest legen das zahlreiche Interviews nahe, in denen wenig mehr aus ihm herauszulocken war als offensichtlicher Schwachsinn und als Fakten getarnter Schwachsinn.
Warum Vögel unfrei sind
Klaus Theweleit hat in seinem Bob-Dylan-Lesebuch „how does it feel“ einige Texte über Dylan zusammengetragen, aus denen hervorgeht, dass man Dylan, trotz seines Abgleitens in Metametaebenen und seines Hangs zum Unfug, doch auch ernst nehmen kann. Man soll nur erstens nicht versuchen, die Komplexität seiner komplexeren Texte auf einfache Erklärungsmuster herunterzubrechen, und es zweitens unterlassen, einfache Texte unnötig zu verkomplizieren.
Dylan ist selbst jemand, der dem Wort misstraut. Das schönste Dylan-Zitat aus dem Buch stammt aus dem lesenswerten Text von Dylans Jugendliebe Suze Rotole: „‚Sind Vögel wirklich frei?‘, fragte er und antwortete selber: ‚Sie sind an den Himmel gekettet und gezwungen zu fliegen.‘“ Was zählen Werte wie Freiheit oder Gleichheit, wenn sie in den USA verfassungsmäßig garantiert sind, am Unabhängigkeitstag gefeiert und dennoch mit Füßen getreten werden (es war die Zeit der Bürgerrechtsbewegung)?
Tränen des Zorns
Und: Was sind Freiheit und Liebe wert, wenn eine ganze Bewegung, die ihre Daseinsberechtigung auf sie gründet, ihren Helden verstößt, weil er sich die Freiheit nimmt, eine E-Gitarre in die Hand zu nehmen? Es war ein Test - und die 60er fielen durch, ihre Form der Liebe und Verehrung suchte Dylan fortan nicht mehr. Auf den „Basement Tapes“ findet sich der Song „Tears of Rage“:
„And now the heart is filled with gold
As if it was a purse
But, oh, what kind of love is this
Which goes from bad to worse?“
Buchhinweise
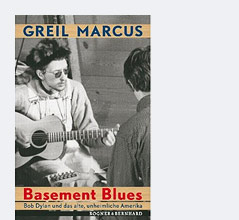
Rogner & Bernhard
Greil Marcus: Basement Blues. Bob Dylan und das alte, unheimliche Amerika. Rogner und Bernhard, 286 Seiten, 14,90 Euro.
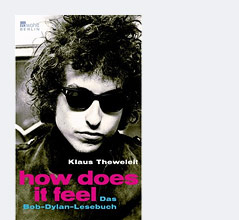
Rowohlt
Klaus Theweleit: how does it feel. Das Bob-Dylan-Lesebuch. Rowohlt Berlin, 302 Seiten.
Tino Markworth: Bob Dylan. monographie. rororo, 158 Seiten.
Das Amerika der Freaks
Mit den „Basement Tapes“ bekannte sich Dylan zum Amerika der Freaks und Außenseiter, zu einem Amerika, wie es etwa Thomas Pynchon später in seinem Roman „Gegen den Tag“ beschrieb und wie es die Beat-Poeten (Ginsberg war ein Freund Dylans) in Romanen von ihren „Hobos“ bevölkern ließen. Die Welt der Jahrmarktfiguren und Herumtreiber wird schon am Cover lustvoll zitiert. Dylan, umringt von der dicken Frau, dem Kleinwüchsigen, dem Gewichtheber, dem Obdachlosen; Dylan, eine Nonne umarmend, The Band mit Bauch- und Balletttänzerin, ein Tonbandgerät, eine Ziehharmonika, eine Tuba, ein Banjo und schließlich eine Kartonschachtel mit der schlampigen Beschriftung „The Basement Tapes“, und dazu der bereits erwähnte Text von Greil Marcus.
Man kann sich die einzelnen Songs wahrscheinlich mühsam bei YouTube zusammenkratzen oder sonstwo herunterladen, wenn man lange genug sucht. Aber in diesem Fall sei es empfohlen, sich eine Vinylpressung aus den Anfangsjahren zu besorgen, die auf eBay je nach Zustand zwischen dreißig und 100 Euro kostet. Selten waren Cover-Artwork und Musik so sehr Einheit. Der Schalk der Fotos und jener der Kompositionen gehen Hand in Hand, und der Sound klingt selbst vom Billig-USB-Plattenspieler so, als säße man mit den Musikern im Keller.
Der Besoffene hat leicht lachen
Die alten Songs, die zum Teil (noch ein Affront) eher an Hillbilly-Country erinnern als an den Folk eines Woody Guthrie, bilden eine mythologische DNA des amerikanischen Weirdtums und des Gesetzlosen. Die gute Stimmung im Keller geht auf den Zuhörer über, wenn ein Besoffener Mrs. Henry auf freche Art und Weise anbettelt, in ihrer Kammer übernachten zu dürfen, obwohl er keinen „Dime“ hat. Wer nichts zu verlieren hat, hat leicht lachen, scheint die Botschaft zu lauten.
Vom Weird Old zum New Weird America
Mitreißend sind freilich auch die eher schon Dylan-typischen, hymnischen Nummern wie „Tears of Rage“ und „Too Much of Nothing“. Und am vielleicht stärksten Song des Albums, der deshalb von Dylanologen in ihren Analysen gerne verschwiegen wird, war Dylan, der nur bei 16 der 24 Nummern gesungen hat, nicht einmal beteiligt: „Bessie Smith“, einer zeitlosen Ode an die gleichnamige Blues-Sängerin, ebenfalls eine Außenseiterin, nachdem in den 30er-Jahren das Interesse an Blues abgenommen hatte.
„Will old times start to feelin’ like new?
When I get there will our love still feel so true?
Yet all I have, I’ll be a-bringin’ it to you
Oh Bessie, sing them old-time blues“
Zu Dylans 70er bieten sich „The Basement Tapes“ für eine neuerliche Wiederentdeckung an, ob mit dem Text von Greil Marcus oder einfach zum Anhören und Anschauen - also Ekstase statt Exegese. Die alten Zeiten fühlen sich längst wieder neu an, nicht nur im Weird Old America, auch im New Weird America.
Simon Hadler, ORF.at
Link: