Zu spät beim eigenen Begräbnis
Arthur Schnitzler war ein akribischer Chronist seines Lebens. Er führte Tagebuch - und beschrieb dort mehr als fünfzig Jahre lang immer wieder seine Träume. Gegen Ende seines Lebens sammelte er diese Aufzeichnungen für einen gesonderten Band. Nun ist erstmals eine aufwändig editierte Version der Träume Schnitzlers erschienen. Sie birgt Überraschungen.
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
Schnitzler war ein Schriftsteller, der um den Effekt von Worten wusste. Er hatte den Aufschrei wegen des Bettgeflüsters im „Reigen“ vorhergesehen. Seine Werke können getrost als Seismographen des Aufregerpotenzials der Gesellschaft im frühen 20. Jahrhundert gelesen werden. Und so wundert es nicht, dass Schnitzler seine Träume nicht einfach eins zu eins übernahm.
Manche der Tagebuchfundstücke diktierte er seiner Sekretärin gar nicht, in weitere griff er dramaturgisch ein oder glättete zumindest die Sprache der Notizen. Wieder andere wurden von ihm anonymisiert, um die darin vorkommenden Personen zu schützen. All das und auch viele unverzichtbare biografische Erklärungen zu den Träumen werden im Nachwort erklärt. Nur so weiß man, dass Schnitzler nicht von anonymen „Vorstadtmädeln“ träumte, sondern von Schauspielerinnen und Lebensgefährtinnen.
Männer mit Bärten
Das Buch „Träume. Das Traumtagebuch 1875 - 1931“, herausgegeben von den Wissenschaftlern Peter Michael Braunwarth und Leo A. Lensing, ist anlässlich des 150. Geburtstages von Schnitzler im Wallstein Verlag erschienen. Es lädt zum Schmökern ein und erzählt mehr über das kollektive Unterbewusste der damaligen Zeit als so manche Abhandlung der Jünger von Sigmund Freud. Schnitzler verband mit Freud eine gegenseitige Faszination.
Freud sagte über Schnitzler, dass dieser intuitiv vieles durch Selbstbeobachtung erfasst und schließlich poetisch realisiert habe, was er selbst sich mühselig im Umgang mit Patienten erarbeiten habe müssen. Die beiden scherzten auch über ihre äußerliche Ähnlichkeit, die über die Bärte hinausging. Schnitzler las Freuds Schriften, vor allem jene über die Träume, mit großem Interesse. Freud tauchte auch hin und wieder in seinen Träumen auf.
Nicht jeder Spargel ein Penissymbol
Letztlich aber lehnte Schnitzler in seinem Text „Über Psychoanalyse“ eine allzu eindimensionale, beliebige Auslegung der psychoanalytischen Symbollehre, wie sie etwa Wilhelm Stekel betrieb, ab: „So kann man den Stab oder den Baum am Ende als Adam, irgendeine Höhlung als Eva deuten und jeden Traum, wenn man will, als einen Bibeltraum.“ Nicht jeder Spargel müsse gleich ein Penis sein. Schnitzler gab Stekel auch eine Abfuhr, als dieser ein Buch über die Träume von Dichtern schrieb.
Schnitzler träumte wiederholt über die Psychoanalyse, er formulierte, darf man den Notizen glauben, im Schlaf sogar Gedanken wie jenen: „Der nächste grosse Mann wird der sein, der der Psychoanalyse ihre genauen Grenzen anweist.“ Und er verbat sich in einer Notiz, auch noch seine Träume über die Analyse zu analysieren: „Meine Kritik der Psychoanalyse braucht keine Deutung mehr.“ Allerdings kritisierte Schnitzler Freud niemals offen.
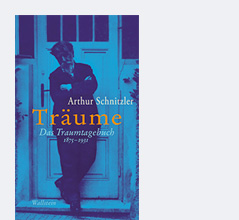
Wallstein Verlag
Buchhinweis
Arthur Schnitzler: Träume. Das Traumtagebuch 1875 - 1931. Wallstein, 494 Seiten, 35,90 Euro.
Erotik im Schlafrock
Hätte Freud die Träume Schnitzlers gekannt, sie wären ein gefundenes Fressen für ihn gewesen, sogar noch nach der Selbstzensur durch den Dichter. In einem Traum von 1916 heißt es: „(...) sie macht mir Vorwürfe wegen Untreue;- plötzlich sind wir im Prater zwischen Buden, sie noch verstimmt, ich erhebe mich, fliege im Schlafrock, über ihr, ziehe sie zu mir herauf, worauf der Traum einen erotischen Charakter annimmt.“ Verschämt verschweigt Schnitzler den erotischen Inhalt.
Im selben Jahr: „In einem kleinen Vorraum junges Wesen, St., nackt, will mich zurückhalten. (...) Sie war schon früher meine Geliebte. Ich brenne darauf, sagt sie, endlich wieder.“ Abgesehen von Diskretion und der Angst, sich öffentlich bloßzustellen, hat Schnitzler wohl auch deshalb manche Teile seiner Träume verschwiegen, weil es ihm peinlich war, sie seiner Sekretärin Frieda Pollak zu diktieren. So heißt es im Nachwort des Traumbuchs, Schnitzler habe von einer „halbnackten Cocotten“ geträumt, für die er „Prästervativs“ vorbereitete (1918). Das habe er Pollak nicht diktiert.
Deutschnationale und Antisemitismus
Auch berufliche Unsicherheiten prägen viele der Träume: „Ich beklage mich bei Gustav, dass ich am Burgtheater beinahe nicht gespielt werde.“ Alle möglichen Menschen, prominente genauso wie weniger prominente Wegbegleiter, stritten mit Schnitzler in seinen Träumen über Stücke und Romane, die sie tadelten.
Die Zeitgeschichte spielt eine Rolle, und hier besonders der Antisemitismus, von dem Schnitzler als Jude immer wieder betroffen war. So empört sich der Autor 1916 träumend über einen Demonstrationszug von jungen Deutschnationalen für den Krieg: „Ehrlos, so zu demonstrieren, wenn man nicht sofort selbst in den Schützengraben geht. Einer blond und höflich: Sie verstehen nicht, was Ehre, da Sie ein Jude sind. Ich (ungefähr): Sie haben jedenfalls mehr Ehre als ich, denn Sie haben die Ehre, mit mir zu sprechen und ich habe nur die Ehre, mit Ihnen zu sprechen.“
Hinweis
Derzeit finden in Wien zahlreiche Theateraufführungen und andere Veranstaltungen aus Anlass von Schnitzlers Geburtstag statt - mehr dazu in oesterreich.ORF.at.
Halbnackt vor dem Kaiser, Kokain für Klimt
Eine prägende Figur scheint für Schnitzler der Kaiser gewesen zu sein. Oft trifft er ihn im Traum. Einmal schaut der Monarch nur böse, ein anderes Mal plaudert er sogar gönnerhaft mit Schnitzler. Dann wieder treffen einander die beiden, und Schnitzler muss sich voll Scham eingestehen, unzureichend oder überhaupt kaum bekleidet zu sein. Wichtig scheint für den Autor auch Klimt gewesen zu sein, dem er einmal im Traum die Einnahme von „Cocain“ rät und dann schreibt: „Ich liebe ihn (Klimt) im Traum sehr (noch mehr als in Wirklichkeit).“
Todesfantasien ein Leben lang
Und Schnitzler verarbeitete Schicksalsschläge, von seinen Trennungen bis hin zum Suizid seiner Tochter Lili im Jahr 1928: „Wieder der Traum, dass ich weiss Lili will sich in einiger Zeit umbringen;- ich kniee an ihrem Bet, (...) ich flehe sie an, es nicht zu thun;- wage es nicht recht;- sie ist kühl; als verstände sie nicht oder wollte nicht verstehen;- wie ich sie küsse,- ist sie deutlich abwehrend;- ich erwache - froh, dass es ein Traum und erst in der Sekunde drauf weiss ich, dass ... was schon geschehen ist. (ich sah gestern viele ihrer Bilder, wegen Rahmungen etc.)“
Schnitzler träumte häufig vom Tod anderer Menschen und von Leichen, ganz besonders oft aber vom eigenen Tod. 1889, der studierte Mediziner und angehende Schriftsteller war 27 Jahre alt, notierte er etwa: „Heute Nacht ein entsetzlicher Traum; ich komme zu spät zu meinem Begräbnis, werde schon erwartet. Stehe vor dem Haustor und sehe die Kränze und suche zu erraten, von wem sie sind. Bin tief betrübt. Habe Angst, mich in den Sarg zu legen, dann redet mir die Mutter zu. Ich denke, die Betäubung wird schon kommen.“ Schnitzler starb 1931 im Alter von 69 Jahren an einer Hirnblutung.
Simon Hadler, ORF.at
Links: