„Ich gestatte Ihnen alle Seitensprünge“
August Strindberg, der vor 100 Jahren verstorbene schwedische Modernisierer von Literatur und Theater, schlitterte in eine Lebenskrise, als er sich gute drei Jahre lang in Oberösterreich aufhielt. Seine Zeit in Perg und Umgebung war von einer Ehehölle, Selbstzweifeln, Armut, okkulten Wahnvorstellungen und alchemistischen Forschungen geprägt.
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
Strindberg war zuvor als 30-Jähriger mit seinem satirischen Roman „Das rote Zimmer“ bekannt geworden. Er arbeitete zu diesem Zeitpunkt als Journalist und nahm in dem auch heute noch mit Gewinn zu lesenden Buch seine kreative Umgebung - mit ihrem Leben zwischen Prekariat, Party und Selbstüberschätzung - genauso auf die Schaufel wie die Bürger- und Beamtenschaft Schwedens. Sein Umgang mit dem Establishment wurde danach nicht besser, Strindberg erarbeitete sich einen Ruf als Skandalautor über Schweden hinaus. Er verließ seine Heimat schließlich nach einem Gerichtsprozess wegen Gotteslästerung für viele Jahre.
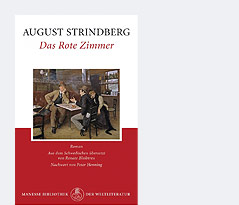
Manesse Verlag
Buchhinweis
August Strindberg: Das rote Zimmer. Mit einem Nachwort von Peter Henning. Manesse, 570 Seiten, 25,70 Euro.
So fortschrittlich Strindberg in seinem naturalistischen Stil und seinen politischen Ansichten war, so konservativ war seine Haltung zur Frau in der Gesellschaft. Neuere Forschungen belegen zwar anhand von Briefen, dass Strindberg Frauen an sich nicht hasste, was jahrzehntelang als Faktum gegolten hatte, ihnen aber zumindest höchst ambivalent gegenüberstand. Belegt ist seine strikte Ablehnung der feministischen Emanzipationsbewegung - Professorinnen an Universitäten waren ihm ein Graus.
Der „Weiberhasser“ und die Feministin
Strindberg galt auch privat als schwierig, nicht nur, aber besonders im Umgang mit Frauen. Nach vierzehn Jahren der Ehe ließen sich er und seine Frau Siri, das Paar hatte drei Kinder, 1891 scheiden. Strindberg war inzwischen 42 Jahre alt. Ein Jahr später zog er nach Berlin, wo er schon bald zum Star der dortigen Boheme avancierte und die 20-jährige österreichische Journalistin Frida Uhl kennenlernte. Die beginnende Beziehung der beiden war 1893 ein gefundenes Fressen für die Klatschpresse: Würde Uhl, die als wilder Freigeist bekannt war, den „Weiberhasser“ bändigen können?
Uhl hätte wissen müssen, worauf sie sich einließ - und heiratete ihn dennoch. Friedrich Buchmayr, dessen Uhl-Biografie „Madame Strindberg oder die Faszination der Boheme“ im Vorjahr erschienen ist, schrieb in einem Beitrag für Ö1, dass die Ehe der beiden nur wenige Monate lang glücklich war, von November 1893 bis zur Geburt der Tochter Kerstin im Mai 1894. Die beiden lebten zu dieser Zeit wegen finanzieller Engpässe zusammen im Gutshof der Familie Uhl im oberösterreichischen Dornach bei Saxen - mehr dazu in oe1.ORF.at.
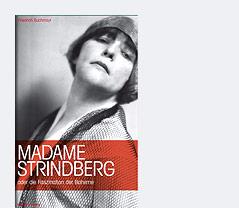
Residenz Verlag
Buchhinweise
Friedrich Buchmayr: Madame Strindberg oder die Faszination der Boheme. Residenz, 367 Seiten, 26,90 Euro.
August Strindberg und Frida Uhl; Friedrich Buchmayr (Hrsg.): Wenn nein, nein! Briefwechsel. Bibliothek der Provinz, 240 Seiten, 19.99 Euro.
Keine Lust auf freie Liebe
Da beide viel verreisten und sich über die Spanne ihrer ohnehin kurzen Beziehung erstaunlich selten an ein und demselben Ort aufhielten, sind die wenigen Aufs und vielen Abs ihrer Liebe detailliert in Briefen nachzuvollziehen. Das Problem der beiden betraf Weltanschauungen und wirkte tief ins Private hinein. Strindberg lobte zwar Uhls Artikel anfangs übeschwänglich. Aber er wollte eine brave Ehefrau, die sich um die Kinder kümmert und nur nebenher hin und wieder einen Essay schreibt.
Uhl hingegen wollte ihren eigenen Weg gehen, bot auch Strindberg rasch und unumwunden die totale Freiheit an: „Ich gestatte Ihnen alle Seitensprünge, nach denen Ihr Herz begehrt. Ich weiß, dass das überhaupt keine Bedeutung für die Liebe hat.“ Er hingegen erging sich in rasender Eifersucht: „Handelst du mit Absicht und bewusst oder ist es deine schmutzige Natur, die dich treibt? In London ist dein Ruf gefestigt nach deinem Abendessen in der Öffentlichkeit mit einem jungen Mann. Du als Jungvermählte!“
Alchemie und Esoterik
Uhl hielt dem Druck nicht lange stand und trennte sich bereits im Herbst 1894 von Strindberg, auch wenn die Scheidung erst 1897 erfolgte. Strindberg schlitterte in eine tiefe Depression. Er verbrachte noch bis November 1896 viel Zeit in Österreich in der Nähe seiner Tochter und der Familie von Uhl, der er auch Geld schuldete. Da er zu dieser Zeit wenig Literarisches veröffentlichte und sich der Naturwissenschaft, eigentlich der Alchemie, zuwandte, wurden die finanziellen Probleme immer drängender.
Strindberg wanderte während seiner Zeit in Österreich viel in der Gegend von Saxen und Klam durch die Wälder und über die Felder. Er malte symbolistische Naturbilder, schrieb sein pseudowissenschaftliches, nicht nur aus heutiger Sicht abstruses Werk „Antibarbarus“ und verfasste feuilletonistische Artikel. Zugleich träumte er davon, eine Art esoterisches Männerkloster zu gründen. Die tiefe Religiosität seiner Schwiegermutter hatte ihn beeindruckt.
Oberösterreich als private Hölle
Strindbergs innere Unruhe spiegelte sich in seinen zahlreichen Umzügen in der Gegend um Saxen wider. Die Zeit ab der Trennung wird als Strindbergs „Inferno“-Krise bekannt, weil er sie in dem teils autobiografischen Roman „Inferno. Legenden“ verarbeitete. Strindbergs Zustand verschlechterte sich so weit, dass er schließlich an okkulten Wahnvorstellungen und Halluzinationen litt.
In Strindbergs Werk fanden sich fortan zahlreiche Anspielungen auf oberösterreichische Örtlichkeiten und Personen. Im Roman „Inferno“ verglich er die Klamschlucht mit Dantes Inferno, in „Das Kloster“ rechnete er mit Uhl ab - die sich in einem Brief bitter beschwerte: „Du hast mir Unrecht getan – Unrecht – Unrecht – und so hast du mich auch in die Nachwelt befördert!“
Besonders aber muss das formal für das Theater wegweisende Stationendrama „Nach Damaskus“ im Zusammenhang mit Oberösterreich gesehen werden. Strindberg, der auch malte, fertigte ein Gemälde mit dem Titel „Überschwemmung an der Donau“ an, interpretierte diese in einem Brief als biblische Sintflut und beschrieb sie schließlich in „Nach Damaskus“ als Strafe für die, wie man im Museum in Saxen erfährt, „unrechtmäßige Besitzanhäufung der Dornacher Verwandschaft“. Hier in Oberösterreich am Ufer der Donau trat dann doch wieder der fortschrittliche Strindberg zutage, der zwar ein Heimchen am Herd suchte, aber für die klassenlose Gesellschaft eintrat.
Rückkehr und Abschied
Im November 1896 ging der Autor nach Schweden, seine psychische Krise war ein Jahr später beendet, die produktivste Schaffensphase seines Lebens sollte folgen. Strindberg verstarb 1912 im Alter von 63 Jahren an Krebs.
Frida Uhl hatte nach ihrer Ehe mit Strindberg noch eine Liaison mit dem Dichter Franz Wedekind, aus der ein Sohn hervorging. Sie sollte im Laufe ihres Lebens weiter als Journalistin arbeiten, ein Cabaret in London eröffnen und in den USA Drehbücher für Filme schreiben. Uhl starb 1943 vereinsamt in Salzburg. Die Ehehölle mit Strindberg hatte sie zuvor noch in dem, wie ihr Biograf Bachmayr schreibt, „verklärten“ Erinnerungsbuch „Lieb, Leid und Zeit“ festgehalten. Sie scheint über den „Weiberhasser“ und dessen Österreich-Jahre nie ganz hinweggekommen zu sein.
Simon Hadler, ORF.at
Links: