Keine Lektüre für Erstgebärende
Helen Walsh ist eine glückliche Mutter - heute. Davor ging sie jedoch durch die Hölle. Die 1976 geborene britische Autorin verarbeitet in ihrem dritten Roman die schwerste Zeit ihres Lebens, jene Monate, nachdem ihr Baby 2007 zur Welt gekommen war. Ihr Mantra von damals dient nun als Buchtitel: „Ich will schlafen!“
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
Den Klappentext für die deutsche Ausgabe liefert Charlotte Roche: „So rührend, knallhart und realistisch ist über Geburt und Mutterschaft noch nie geschrieben worden. Ein grandioses Buch.“ Lorbeeren erntete Walsh auch in Großbritannien. Dem „Independent on Sunday“ war sie eine Doppelseite wert, und im „Times Magazine“ durfte Walsh ihre Erfahrungen auf sechs Seiten selbst wiedergeben.
Sie erklärt sich den Erfolg ihres Buches damit, offenbar ein Tabuthema angesprochen zu haben. Tausende E-Mails bekam sie nach der Veröffentlichung des Romans in Großbritannien und den USA, der Inhalt war jedes Mal mehr oder weniger derselbe: Frauen bedankten sich und berichteten über ihre eigene postnatale Depression und über ihre eigenen Schreibabys.

Jenny Lewis
Helen Walsh - Autorin und Mutter
Halluzinationen wegen Schlafmangels
Schon die Geburt selbst war für Walsh ein Horrortrip. Vom Platzen der Fruchtblase bis zur Entbindung vergingen knapp sechzig Stunden, während denen sie kaum eine Minute Schlaf abbekommen hatte. Dreimal wurde die damals Dreißigjährige wieder weggeschickt, weil ihre Wehen laut Messgerät noch nicht stark genug waren. Beim vierten Mal schaffte sie es gerade noch rechtzeitig in die Klinik.
Auch nach der Geburt war an Schlaf nicht zu denken, weil das Kind an einem Magenproblem litt. Immer wieder erbrach es nach dem Trinken die Muttermilch, der Hunger wurde deshalb nie ganz gestillt, der Säugling schrie und schrie - und schrie. Walsh wurde aus Schlafmangel psychotisch und depressiv. Sie delirierte und hatte monatelang Halluzinationen. Längst Verstorbene saßen plötzlich an ihrem Bett.
Sture Einzelkämpferin
Dass sie heute ihre Depressionen und die Psychose wieder los ist, schreibt Walsh unter anderem der therapeutischen Wirkung des Verfassens von „Ich will schlafen!“ zu. Die Hauptfigur Rachel macht darin im Großen und Ganzen dasselbe durch wie Walsh, allerdings um ein paar entscheidende Nuancen gesteigert. Während die Autorin liebevoll von ihrer Mutter und ihrem Partner unterstützt wurde, will sich die sture Romanfigur partout als Einzelkämpferin durchschlagen.
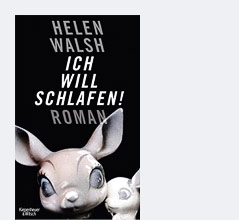
Kiepenheuer & Witsch
Buchhinweis
Helen Walsh: Ich will schlafen! Kiepenheuer und Witsch, 320 Seiten, 20,60 Euro.
Walshs Heldin Rachel arbeitet in Liverpool als Sozialarbeiterin, ist eine Frau der Tat und stolz auf ihre Unabhängigkeit. Sie freut sich auf „die Bohne“, wie sie ihr ungeborenes Kind aufgrund eines Ultraschallbildes nennt. Vater ist Ruben, eine Jugendliebe Rachels. Die beiden hatten sich nach fünfzehn Jahren zufällig wiedergetroffen und schnellen Sex gehabt. Nun will sie ihm nichts von ihrer Schwangerschaft erzählen.
Auch die eigenen Eltern fallen als Stütze weitgehend aus. Ihre Mutter war schon vor Jahren an Krebs gestorben und der Vater bietet Hilfe immer nur in Kombination mit seiner neuen Lebensgefährtin an - und gegen die ist sie allergisch. Rachel hat zudem keine wirklichen Freunde. Liebgewonnene Arbeitskollegen kommen als Unterstützung nicht infrage - in ihrem professionellen Umfeld will sie tough sein und keine Schwächen zeigen.
Spirale aus Wahn und Verzweiflung
Also folgt, was viele Eltern kennen, die ein Schreibaby haben: Gewaltphantasien, die sich gegen sie selbst und ihren Sohn richten; einen Sohn, der ihr so gar nicht ähnelt - er ist ein Schwarzer wie sein Vater und hat von Rachel höchstens die Grübchen. Deprimiert, von Schlafmangel, Ängsten und schließlich Wahnvorstellungen gequält, kann sie für den kleinen Joe nichts empfinden. In seinen Augen sieht sie Hass.
Längst nicht mehr Herrin ihrer Sinne, muss Rachel in ihren hellen Momenten um das Leben des Babys fürchten - weil sie nicht weiß, wie weit sie in jenen Phasen der Verzweiflung geht, in denen sie weggetreten ist. Als Leser wird man vollkommen in den Bann des Romans gezogen und bangt um Rachel und den kleinen Joe. Die Spirale aus Wahn und Verzweiflung dreht sich bis zum Finale immer schneller.
Trösteprosa und Thriller zugleich
Das Buch, übersetzt von Maria Hummitzsch, bietet mit Sicherheit kein literarisches Erlebnis. Über hohle Sprüche, die seit Jahren aus der Mode gekommen sind („Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt“), muss man immer wieder hinwegsehen. Ihr letztes, ansonsten in höchsten Tönen gelobtes Skandalbuch „Millie“ über wilden Sex und Drogenpartys brachte Walsh vonseiten der „taz“ den Vorwurf „rührselig-deterministischer Besinnungsprosa“ ein. Das trifft streckenweise auch auf „Ich will schlafen!“ zu.
Nichtsdestotrotz funktioniert der Roman erstens als Trösteprosa für Betroffene und nimmt den Leser zweitens auf eine packende emotionale Tour des Grauens mit, die ihresgleichen sucht und in der immer wieder feiner Humor aufblitzt. Das Thema Mutterschaft wird dabei aus mehreren Perspektiven umkreist. Rachel und Joe, Rachel und die Erinnerung an ihre eigene Mutter - und Rachels Verantwortung als Sozialarbeiterin für „Problemjugendliche“ in Liverpool.
Für Betroffene und Veteranen
Nicht zu empfehlen ist das Buch für Schwangere, die meist ohnehin schon darunter zu leiden haben, dass jede Mutter im Freundes-, Kollegen- und Verwandtenkreis ihnen ungefragt, genüsslich und gedankenlos von den Schwierigkeiten und Schmerzen bei der Geburt der eigenen Kinder berichtet. Vorbereiten kann man sich auf ein Schreibaby, eine postnatale Depression und eine Psychose ohnehin nicht. Als therapeutische Maßnahme für Betroffene und Veteranen sei Walshs Roman hingegen wärmstens empfohlen.
Simon Hadler, ORF.at
Links: