Die Rache der Musikkassetten
Liebesromane gibt es viele. Anti-Liebesromane auch. Letztere sind oft unterhaltsamer. Man denke an Wilhelm Genazinos männliche „Helden“, die an Frauen verunglücken und noch mehr an sich selbst. Jetzt hat auch der nicht unter Romantikverdacht stehende „Zeit“-Kolumnist Harald Martenstein ein Beziehungsbuch vorgelegt - und einer Frau gleich 23 Männer zur Seite gestellt.
Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.
„Gefühlte Nähe“ nennt Martenstein seinen „Roman in 23 Paarungen“, und man muss kein Hellseher sein, um zu ahnen, dass Martenstein der echten Nähe wenig Chancen auf Verwirklichung zugesteht. Es mag ja an den Männern liegen, die Martenstein in das Leben der zunächst rätselhaften Frau namens N. schickt. Sie heißen Rühl, Born oder Rost - und heißen sie nicht so, dann schreiben sie Briefe in strengen Tonlagen: „Es ist jetzt Sonntagnachmittag, und wenn ich nicht mit Dir reden kann, schreib ich eben. Denk bitte nicht, dass ich sauer oder beleidigt bin. Wenn Du keine Zeit zum Anrufen hast, ist das schon okay.“ Aus den Erzählungen der Liebhaber, ihren „Paarungen“ mit N., entsteht das, was man vorsichtig einen Roman nennen könnte.

Verlagsgruppe Randomhouse
Harald Martenstein, streitbarer Kolumnist beim „Tagesspiegel“ und der „Zeit“, legt seinen zweiten Roman vor.
Nachts auf der Klassenfahrt
N.s erster Liebhaber ist ihr Deutschlehrer, der auf der Klassenfahrt durch die nachts in sein Zimmer eintretende N. aus dem Liebesorbit mit seiner Kollegin Sybille Bär geschossen wird. Konsequenterweise lokalisiert der Lehrer diesen Ausrutscher im Umfeld des Selbstmordes von Heinrich von Kleist und seiner Geliebten Henriette Vogel („Henriette Vogel war eine Geisel, die hingerichtet wurde, um die Welt zur Hochachtung für einen überspannten Literaten zu erpressen“), nicht ohne zugleich wahre Emotionen zu zeigen: Nach dem Geständnis der Affäre bei Frau Bär heult der Lehrer auf dem Sofa im Wohnzimmer des Schuldirektors.
Für solch dramatische Szenen hat Martenstein passende Orte aus seiner Jugend parat: das aufregende Mainz-Gonsenheim. Ein Hauch von „Unser Lehrer Doktor Specht“ liegt über dem Roman - und man ist neugierig auf mehr.
Passagenwerk für Facebooker
Martenstein liebt die absurde Verdichtung, doch manchmal geht dem Erzähler dann doch sehr der „Zeit“-Kolumnist und der Hang zur Produktion zitabler Sätze durch. Facebook-Addicts sollten unbedingt zu diesem Buch greifen. Hier liegt eine große Zitatesammlung vor, mit der sich viele Statusmeldungen garnieren und noch mehr „Likes“ im Sozialen Netzwerk ihres Vertrauens generieren ließen.
Fraglich allerdings erscheint, warum es 23 Männer braucht, um das ohnedies nie zu Stande kommende N.-Panoptikum zu nähren. Zwölf Liebhaber hätten es auch getan. Denn bis zur Hälfte des Buches weiß man: N. ist nicht die Frau, der man bis ans Ende der Welt nachreisen würde. Da sind etwa Teddybär-Geschenke an die Männer ihres Herzens und immer wieder selbst gemachte Musikkassetten „schreckliche Musik, wie Vollmann fand“.
Männer ohne Eigenschaften
Vollmann ist so ein typischer Liebhaber von N. Eigentlich will er schon lange raus aus dieser anstrengenden Sache. Doch dann kommt der Schulflohmarkt des Sohns, und während Vollmann den Gedanken an N. nachhängt, wühlt eine Kundin in Vollmanns alter Bordeaux-Kiste. Irgendjemand hat dieses Relikt aus seiner Werkstatt mit auf den Flohmarkt gebracht. Und ausgerechnet in dieser Kiste, ganz unten auf dem Boden, hatte Vollmann alle Liebesbriefe und -gaben von N. aufbewahrt. Während eine Kundin nach dem Preis eines abgeranzten Bratententhermometers fragt, hält Vollmanns Frau Monika N.s Liebesergüsse in der Hand: „Monika blickte auf. Vollmann lächelte sie an. Er wusste jetzt wirklich nicht mehr weiter. Exitus.“
„Perfekt ist niemand“
„Auf dem Partnermarkt herrscht das Gesetz von Angebot und Nachfrage. Du willst als Käufer für dein Kapital den bestmöglichen Gegenwert. (...) Eine gut aussehende, intelligente Frau auf Partnersuche ist also in der gleichen Position wie jemand, der 20 Millionen hat und sich dafür ein Haus kaufen will. Im Grunde kann sie, da sind wir uns sicher einig, fast jeden Typen haben. Aber das macht es nicht einfacher, sondern schwieriger. Perfekt ist niemand. Du hast also 20 Millionen und sollst dich mit etwas Unperfektem abfinden?“
Immer wieder steuert Martenstein mit großer Lust jene Momente an, in denen sich zwei Menschen nichts mehr zu sagen haben. Hier spielt der Autor seinen größten Trumpf aus: die Beschreibung des Lapidaren. „Was ich besonders schön finde“, lesen wir im Kapitel vier, „sind die Telefongespräche, in denen uns beiden nichts mehr einfällt und wir beide nichts mehr sagen, sondern nur noch dem anderen beim Atmen zuhören“.
Der Roman und seine Leerstellen
Die besten Geschichten spinnt Martenstein freilich zwischen den Kapiteln. Manche der Liebesgeschichten mit N. sind durch die Kontakte der Männer untereinander verbunden. So trifft man schon in der ersten Erzählung auf Doubek, der später mit N. innige Momente pflegen wird. Bis zu seinem Auftritt als Liebhaber von N. lässt Martenstein seine Figur Doubek aber ordentlich schmoren: Doubek ist Taxifahrer in Frankfurt und sieht die schon in seiner Schulzeit angebetete N. mit einem schmächtigen Mann aus reichem Haus in sein Auto steigen.
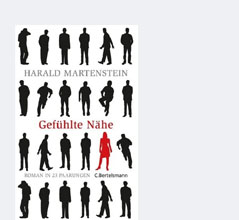
Bertelsmann
Buchhinweis
Harald Martenstein: Gefühlte Nähe. Roman in 23 Paarungen, Bertelsmann, 222 Seiten, 20,60 Euro.
Für Doubek ist das eine narzistische Kränkung, die dieser nur durch innige Bezugnahme auf Gott zu kompensieren vermag. „Sein Vorbild war Gott. Doubek war nicht im Geringsten gläubig, aber er fand Gott als Idee interessant. Eine oberste Instanz, die undurchschaubar und unberechenbar ist und das Gute wie das Böse zulässt und die dafür von den Menschen noch jahrtausendelang verehrt wird. Wenn die Leute so etwas brauchten, dann sollten sie es bekommen, warum nicht zum Beispiel von Doubek.“ Bis zur Eroberung von N. bleibt Gott-Doubek Taxilenker, der als Tippgeber an Einbruchsdelikten in Villen gut mitverdient. Danach folgt eine „relativ lange“ Beziehung mit N.: Sie dauert ganze zwei Jahre.
Alle sind austauschbar
Ein bisschen verloren hält man das Buch am Schluss in den Händen. 23 Paarungen mit Männern ohne Eigenschaften - da fallen schon die schlechten Gespräche über Sex und selbstverliebtes Vor-sich-hin-Philosophieren zu zahlreich aus.
Dass, wie dem Lektorat des Romans entgangen, ein Charakter mal „Rost“ und ein paar Seiten weiter wieder „Rust“ heißt, mag man in diesem Panoptikum belangloser Männlichkeit verschmerzen. Alle sind austauschbar. Auch N., die ihrer Mädchenrolle und den alten Wollpullovern nicht entwachsen kann: Wer Element of Crime für den Partner auf Kassetten spielt, kann nicht mehr erreichen wollen, als bestenfalls „gefühlte Nähe“: „Ich bin jetzt immer da wo du nicht bist/Und das ist immer Delmenhorst.“
Gerald Heidegger, ORF.at
Links: