Regieren ist kein Zuckerschlecken
„House of Cards“ steht dabei als Sinnbild dafür, wie rasch das Fundament der Macht ins Wanken kommen kann. In Österreich zieht ab der kommenden Legislaturperiode das Parlament in ehemals imperiale Räume. Und auch die Regierung, sie sitzt seit der Ersten Republik an einem Ort, an dem das politische Tagesgeschäft ein geheimer, mitunter aber auch gut belauschter Vorgang war, wie man ja von der Nutzung der Staatskanzlei auf dem Ballhausplatz zu Zeiten des Wiener Kongresses weiß.
In seiner gut 300-jährigen Geschichte sei der Ballhausplatz ein Schauplatz vieler Intrigen und Machtspiele gewesen, argumentiert der frühere rote Sektionschef im Innenministerium, Manfred Matzka, in einem dieses Jahr erschienenen Buch zur Geschichte der Staatskanzlei. Mittlerweile sei das nicht so, versuchte Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) bei der Präsentation dieses Werks dem Gebäude den Nimbus des Abgründigen bis Gefährlichen zu nehmen.
Dass es in der Geschichte dieses Hauses brutale Auseinandersetzungen gegeben hat, ist evident. Mit dem Putschversuch gegen das Ständestaat-Regime durch eine Gruppe von Nationalsozialisten wurde der Ballhausplatz zum tragischen Ort. Der damalige Kanzler Engelbert Dollfuß verblutete nach einem Schussattentat in seinem Amtszimmer. Und die Frage, wie prominent man dieses Umstandes an Ort und Stelle gedenkt, war in der Geschichte des Hauses auch eine politischer Positionierungen.
Welche Serie kommt der Realität näher?
Für die Gegenwart bemühen ja Serien das Bild von mehr oder weniger gefährlichen Auseinandersetzungen auf dem politischen Parkett. Dass Politik sprichwörtlich über Leichen gehen kann, ist für Peter Filzmaier eines der Argumente, die er gegen die US-Serie „House of Cards“ vorbringt. Dann schon eher „Borgen“, verriet er gegenüber ORF.at, zumal dort auch die Spannung zwischen Politik und Privatleben, das durch das Getriebe der Politik unter die Räder kommt, durchaus lebensnah dargestellt sei.
Borgen oder House of Cards
Der langjährige Kommentator der Innenpolitik, Peter Filzmaier, zur Frage, welche TV-Serie der Politrealität am nächsten kommt. Eigentlich, so meint er, hätte er ja eine Neigung zur US-Politik ...
In Dänemark, wo die Serie „Borgen“ einen weniger spektakulären Blick hinter die Kulissen des Regierens wirft als „House of Cards“, hat man die drei Gewalten des Staates überhaupt gleich zusammen in ein gemeinsames Gebäude gesetzt: „Borgen“ („die Burg“), das meint Schloss Christiansborg im Zentrum Kopenhagens, das alle drei Gewalten des Staates beherbergt. Oberster Richter, Premier und Parlament („Folketing“) sind in dem Gebäudekomplex dieses Königsschlosses untergebracht.

DR tv
Obwohl eine ganze, weltweit erfolgreiche TV-Serie auf das Gebäude von Parlament und Premier Bezug nimmt, sieht man meist nur Innenräume. Sidse Babett Knudsen als Birgitte Nyborg agiert meist im Innenraum ihrer Machtzentrale. Für die Dreharbeiten wurde diese im Keller des dänischen Rundfunks aufgebaut.
Rund um die Burg ist das Austro-„Borgen“
Österreichs „Borgen“, das ist im Jahr 2017 tatsächlich ein Bezirk um eine „Burg“: Kanzler und Außenminister sitzen Face to Face am Ballhausplatz 2 bzw. Minoritenplatz 8, direkt am Rand der historischen Kaiserburg, wo ja im Nordwestflügel der Bundespräsident, der die Regierung formal ernennt, residiert.
Und das Parlament? Es zieht in diesem Jahr direkt ins österreichische „Borgen“, nämlich den Redoutensaal der Hofburg, also jenen Trakt aus dem 18. Jahrhundert, der vom ehemaligen Theater- und Opernhaus zum Galasaal für Großveranstaltungen umgebaut worden war.

ORF.at/Roland Winkler
Umbau am Imperialen für die parlamentarische Arbeit der Republik
Seit dem Hofburg-Brand 1992 ist der Redoutensaal ja einer der zentralen Konferenzsäle im Herzen Wiens. Unter den großen Tableaus des Malers Josef Mikl nehmen ab Oktober die 183 Abgeordneten des neugewählten Nationalrates Platz, weil der bisherige Plenarsaal im Parlamentsgebäude Theophil Hansens umgebaut wird.

ORF.at/Roland Winkler
Das Parlament im Redoutensaal. Im Ausweichquartier, wo einst Opern, Theater und Bälle ihre Heimat hatten, wird ab Herbst debattiert und abgestimmt.
Vom „Jeu de Paume“ zum Regierungspalais
Hat das Parlament durch den Umbau am Ring seine Heimat in einem ehemaligen Opern- und Theaterraum gefunden, so wird das Handwerk des Regierens auch im republikanischen Österreich an einem Ort betrieben, an dem einst die österreichische Version des „Jeu de Paume“, des Ballspiels mit Holzschlägern in Innenräumen, betrieben wurde.
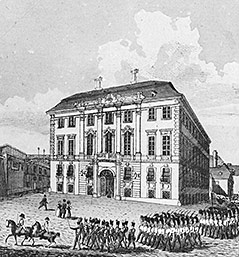
picturedesk.com/ÖNB-Bildarchiv/Karl Vasquez
Der Ballhausplatz in einer Ansicht des frühen 19. Jahrhunderts
Der Begriff „Ballhaus“ meint in gewisser Weise eine frühneuzeitliche Tennishalle, und keineswegs einen Ort rauschender Feste - dafür war schließlich das unter Maria Theresia umgebaute Theatergebäude in der eigentlichen Habsburger-Residenz vorgesehen.
Der lange Schatten des Regierens
Permanente, zentrale Strukturen des Regierens, so erinnert Matzka in seiner Geschichte der Staatskanzlei, hätten sich erst vollends im 18. Jahrhundert ausgebildet. Und dafür wurde schließlich in den 1720er Jahren nach den Plänen von Johann Lucas von Hildebrandt und unter der Aufsicht des Hofkanzlers Philipp Ludwig Wenzel Graf von Sinzendorf die Hofkanzlei errichtet. Das Gebäude sollte in den kommenden Jahren nicht nur Schaltstelle der Macht sein. Es spiegelt immer wieder das Gezerre zwischen der Macht oder Ohnmacht eines Kaisers und dem obersten Hofbeamten wieder.

ORF.at
Am Anfang war das Palais am Ballhausplatz noch ein überschaubares Gebäude, wie diese Zuckerversion verdeutlicht. Als Außenamt nach 1848 erfuhr es zahlreiche, auch bauliche Erweiterungen, die die Dimensionen des alten Lucas-von-Hildebrandt-Palais weit überstrahlen.
Zwischen Kaunitz und Metternich
Legendäre Figuren in der Staatskanzlei waren Wenzel Anton Graf von Kaunitz, der gleich die Regentschaft von vier Kaisern erlebte und prägte, und schließlich Klemens Wenzel Lothar Graf von Metternich, der den in den Napoleonischen Kriegen so erfolglosen Johann Philipp Graf Stadion ablöste und eine Tatsache der Regentschaften am Ballhausplatz verdeutlicht: Übergeben wird die Macht nicht selten an jene Person, die schon lange am eigenen Stuhl sägt.
„Müssen uns aufs Lavieren beschränken“
„Wir müssen (...) unser System auf ausschließliches Lavieren, auf Ausweisen und Schmeicheln beschränken“, notierte der junge Metternich in der Frühphase seiner Politik bei Hofe, als noch die Kriege gegen Napoleon auf einem Höhepunkt standen. Und schloss mit einem scheinbar genuin österreichischen Wirklichkeitssinn: „Uns bleibt demnach nur ein Ausweg: Unsere Kraft auf bessere Zeiten aufzuheben, an unserer Erhaltung durch sanftere Mittel - ohne Rückblick auf unseren bisherigen Gang - zu arbeiten.“
Dass Österreich vor dem Wiener Kongress freilich eine zentrale Rolle in der Koalition gegen Frankreich bekam, lag dann doch weniger am Zuwarten denn am geschickten Zupacken des Außenpolitikers Metternich.

picturedesk.com/akg-images
„Le beau Clement“, der schöne Clemens, wurde der in Koblenz geborene Klemens Wenzel Lothar von Metternich in seiner Pariser Zeit genannt. Zunächst als „Franzosenfreund“ verschrien, holte er mit diplomatischem Geschick den Kongress zur Neuordnung Europas nach den Napoleonischen Kriegen nach Wien.
Da Metternich wenig dem Zufall überlassen wollte, vor allem alles, was sich in den Gemäuern der Staatskanzlei abspielte, baute er ein dichtes Überwachungssystem auf. Selbst die Briefe der Kaiserin, die dem „Franzosenfreund“ Metternich misstraute, wurden von Metternich überwacht - abgefangene Briefe gaben auch ein Bild eines ermüdeten Ehelebens beim Kaiserpaar.
Ein Zuckerbäcker im Staatspalais
Dass Regieren und Wohnen zu Beginn des 19. Jahrhunderts weniger getrennt waren als heute, zeigt auch die Ausrichtung des Staatspalais. Es wurde gekocht, gewaschen, und auch die Kinder der Metternichs liefen selbst noch zu Zeiten des Wiener Kongresses durch Stiegenhäuser des Palais am Ballhausplatz.
Im Keller hatte man eine eigene Zuckerbäckerei untergebracht, und in vielerlei Hinsicht war das Gebäude zwar eine olfaktorische Wunderkammer zwischen Pferdegestank, Abwässern, frisch Gekochtem und Gebackenem. In gewisser Weise aber war man im Vergleich zu heute durchaus autark, was die innere Versorgung des Gebäudes zwischen Staats- und Privataufgaben anlangte. Alles Gründe, dass man am Ende auch den Wiener Kongress in diesem Gebäude abhielt - und in die Soireen der umliegenden Gebäude ausströmen und auch, so liest man, lustwandeln konnte.
Ein Haus mit vielen Namen
- 1743: „Kaiserliche Königliche geheime Hof- und Staats-Canzley der auswärtigen Geschäfte“
- 1757 – 1793: „K. K. geheime Hof- und Staats-Canzley der auswärtigen, Niederländischen und Italiänischen Geschäfte“
- 1811 – 1820: „K. K. geheime Haus-, Hof- und Staatskanzlei für die auswärtigen Geschäfte“
- 1867 - 1918: „K. u. k. Ministerium des kaiserlichen Hauses und des Äußeren“
- „Ballhausplatz“ ist bis heute die Bezeichnung für das politische Machtzentrum der Republik. Sowohl das Bundeskanzleramt als auch das Außenministerium können sich auf die Staatskanzlei als Vorläuferinstitution beziehen. Erst 2005 wurden Bundeskanzleramt und Außenministerium auch räumlich getrennt.
Was dringt nach außen, wie viel muss man wissen?
Metternich war unter allen Bewohnern des Ballhausplatzes sicher das Mastermind der Überwachung und einer, der mit Hilfe von über der Belüftung postierten Gesprächsprotokollanten nichts dem Zufall überlassen wollte. Wie viel aus dem Regierungsgeschäft nach außen drang, war, wie die Geschichte der Staatskanzlei zeigt, ein ständiges Thema. Mal hatte man es mit verschwiegenen Kanzlern zu tun, mal drang so gut wie alles im Gebäude Verhandelte an die Öffentlichkeit.
Wie transparent und oder auch wie geheim Politik ablaufen muss, ist für den Politologen Filzmaier in einer Demokratie der Gegenwart eine klare Sache: „Politik trifft Entscheidungen, die unser aller Zusammenleben regeln, betrifft also jeden. Wenn ich in der Regierung bin, hab ich ein öffentliches Amt und bin zur Kommunikation mit der Öffentlichkeit verpflichtet.“ Das sei in privaten Unternehmen anders.
„Man muss kommunizieren, und es muss Rituale geben, die eine Gleichheit der Information herstellen, wo also ein Kanzler oder Minister allen Medien zur Verfügung steht“, so Filzmaier.
Blackbox Politik
Die interessierte Öffentlichkeit wisse wohl über vieles Bescheid, was „die formalen Entscheidungsabläufe der Politik“ betreffen. Es sei aber dennoch oft eine Blackbox, so der Politologe, „wie sich etwas real abspielt, etwa was das Verhandeln einer Regierungskoalition betrifft“. Was sich so alles in einer Regierung abspiele, würden wir schon gerne wissen. „Deshalb schauen wir uns entsprechende Serien an. Und wenn es in den Serien oft um Intrigen geht, muss man sagen, dass wir eine ziemliche Lust haben, beim Intrigenspiel zuzusehen“, konstatiert Filzmaier.
„Politik ist eine Blackbox“
„Wir haben auch eine Lust beim Zuschauen, wie sich Intrigen bilden“, so der Politologe Peter Filzmaier. Und oft sei Politik für uns Außenstehende auch eine Blackbox.
Die TV-Serien knüpften nicht zuletzt an den Trend der Personalisierung von Politik an. Die Tatsache, dass man als Person punkten müsse, sei ein bei uns noch junger Trend. Insofern könne die Politik selbst schon von Serien lernen. Und, so Filzmaier: „Wenn Intrigen tragender Bestandteil sind, dann zeigen Serien sehr deutlich auf, dass es Netzwerke und das Schmieden von Netzwerken in der Politik braucht.“
Buchhinweis
Zur Geschichte der einst Geheimen Hof- und Staatskanzlei hat der langjährige Sektionschef Manfred Matzka eine umfangreiche Darstellung vorgelegt.
Manfred Matzka, 300 Jahre Macht und Intrige am Ballhausplatz, Brandstätter Verlag, 288 Seiten, 39,90 Euro.
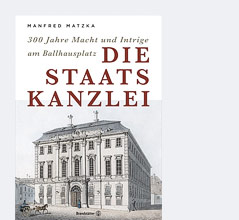
Brandstätter Verlag
Wie viel sollte geheim bleiben?
Wenn Transparenz nun eine große Losung in der Politik ist, dann kommen weder sie noch besonders die Diplomatie ohne das „Arkanum politicum“ aus, also Elemente der Politik, die nicht die Öffentlichkeit erreichen und geheim bleiben sollen. Auch das müsse man, empfahl der deutsche Historiker Karl Schlögel in einem Gespräch mit ORF.at auf dem Höhepunkt der WikiLeaks-Enthüllungen, als kulturelle Leistung erkennen. Er empfahl dabei einen Blick in die Geschichte der Diplomatie nach dem Ersten Weltkrieg.
„Die beiden Revolutionsmächte der Zeit, die Vereinigten Staaten und die Bolschewiki, hatten als gemeinsame Parole den Kampf gegen die Geheimdiplomatie der alten Mächte. Woodrow Wilson war Teil einer Avantgarde im Niederreißen der Geheimdiplomatie“, so Schlögel: „Man hat alle Dokumente, alles, was man herausgeben konnte, herausgegeben, also nichts anderes gemacht als WikiLeaks heute.“
Es sollte das Ende der Geheimdiplomatie sein, das Ende der Kabinettspolitik, der Herstellung von Öffentlichkeit und der Demokratisierung der Außenpolitik, erinnerte Schlögel dabei auch an das berühmte 14-Punkte-Programm Wilsons, in dem es ja gleich zu Beginn heißt: „Diplomatie soll aufrichtig und vor aller Welt passieren.“
Dennoch müsse man Politik und Demokratie, so Schlögel, als einen „kulturellen Komplex“ begreifen: „Der Austausch zwischen Staaten kommt nicht aus ohne das Persönliche. Insofern hat der Gestus von radikalen Aufdeckerplattformen, die jedes Dokument öffentlich machen möchten, etwas Kulturstürmerisches, weil es einen Bereich tangiert, ohne den das Zusammenleben auf der Welt noch nicht möglich ist: Nämlich dass es kein Auskommen gibt ohne das Gespräch auch hinter verschlossenen Türen und dass die Diskretion eine ungeheure Errungenschaft unserer Zivilisation ist.“
Es gebe nun einmal keine „Öffentlichkeit per se in einem fundamentalistischen Sinn“. Eigentlich, so Schlögel, müsste sich die Diskussion darum drehen, wo die Grenze verläuft „zwischen Diskretion als einer kulturellen Errungenschaft und Geheimdiplomatie als zweifelhaftem Geheimbereich des Regierens“.
Die mediale Öffnung des Regierens
In Österreich vollzieht sich spätestens ab Mitte der 1960er Jahre eine mediale Öffnung der Regierungsarbeit. Das Rundfunkvolksbegehren 1964 nahm die in alle öffentlichen Bereiche hineinwirkende Proporzaufteilung des Landes, die bis hinein in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reichte, ins Visier und wollte den ORF zu einem unabhängigen Medium machen.
Und der erste „Medienkanzler“ am Ballhausplatz sollte Josef Klaus von der ÖVP sein, der weniger Scheu als seine Vorgänger im Amt vor Interviews hatte und der auch die Gepflogenheit des Hintergrundgesprächs in die Politik brachte.
Portisch und die Medienpolitik der 60er Jahre
Ein Staatsekretär im Bundeskanzleramt sollte sich eigens um die Öffentlichkeitsarbeit kümmern. Dem Vernehmen nach war Hugo Portisch, der erst 1963 mit dem „Kurier“ die Geheimabsprachen zwischen Alfons Gorbach (ÖVP) und Bruno Pittermann (SPÖ) zur Proporzaufteilung des Landes aufgedeckt und damit einen wesentlichen Stein zur heimischen Mediendebatte ins Rollen gebracht hatte, Wunschkandidat für dieses Amt. Geworden ist es schließlich Karl Pisa, der damals besser in das ministerielle Gehaltsschema passte.
Mit Bruno Kreisky (SPÖ) zog ab 1970 ein Bundeskanzler in den Ballhausplatz ein, der das Medienbewusstsein Klaus’ noch um einiges ausbaute. Ein Drittel seiner Tagesarbeit, so sagt man, habe Kreisky mit Journalisten am Telefon verbracht - und auch soll er es gewesen sein, der sich als Erster für die Verbreitung der damals noch riesigen Mobiltelefone in seiner Politarbeit eingesetzt habe.
Auf dem Balkon vor den Massen
Als Höhepunkt der Politinszenierung auf dem Ballhausplatz gilt bis zum heutigen Tag der Empfang von Karl Schranz und der Auftritt vor Zehntausenden auf dem Balkon des Regierungsgebäudes. Schranz war damals wegen seines Profistatus von den Olympischen Spielen in Sapporo ausgeschlossen worden. Die Inszenierung seiner Heimkehr brachte ihn nicht ganz zufällig auch beim Kanzler vorbei.

picturedesk.com/ÖNB-Bildarchiv/Fritz Kern
Medienstar auf dem Ballhausplatz: Karl Schranz ließ sich im Februar 1972 von den Massen feiern. Kreisky soll diesem Spektakel mit gemischten Gefühlen beigewohnt haben. Allerdings wusste er um die Wirksamkeit von Symbolen.
Für effektive Medienpolitik haben sich seit damals ungewöhnliche Koalitionen und Konstellationen gebildet, und wenn es nur welche für den prägnanten Augenblick waren.
Gerald Heidegger, ORF.at


